Nie wieder Krieg - Die Charta der Vereinten Nationen

Foto: H.S.
Vereinte Nationen - 18.10.2025 - von Michael von Schulenburg
Anlässlich des 80. Jahrestags des Inkrafttretens der UN-Charta am 24. Oktober 2025 hat Michael von Schulenburg einen Text mit dem Titel „Nie wieder Krieg! – Die Charta der Vereinten Nationen“ veröffentlicht. Dazu schreibt er: "In meiner langjährigen Arbeit als UN-Diplomat – in Konfliktregionen von Haiti über Iran und Irak bis nach Sierra Leone und Afghanistan – war die Charta der Vereinten Nationen für mich stets die Grundlage, um Frieden zu schaffen. Heute, als EU-Abgeordneter (BSW), sehe ich ihre Bedeutung dringlicher denn je: Gerade in Zeiten von Aufrüstung, Kriegstreiberei und nuklearer Bedrohung brauchen wir sie als verbindliches Fundament für eine weltweite Friedensordnung.
Die Broschüre versammelt sechs Beiträge, in denen er u. a. die Eskalation der Kriege in der Ukraine und im Iran analysiert, Wege zu einer multipolaren Friedensordnung skizziert und darlegt, welche Risiken aus Deutschlands ambivalentem Verhältnis zur UN-Charta entstehen.
Michael von der Schulenburg
Dieses Buch ist zum Anlass des 80. Jahrestag des Inkrafttretens der Charta der Vereinten
Nationen erstellt worden. Es besteht aus mehreren selbständigen Artikeln zum Thema der
UN-Charta, von denen drei bereits zuvor publiziert wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Nie wieder Krieg – Die Charta der Vereinten Nationen
- Artikel 1
Krieg und Frieden – Die Schicksalsfrage der Menschheit
- Artikel 2
Verhandeln und nicht Schießen
- Artikel 3
Die UN-Charta und die zukünftige Friedensarchitektur
- Artikel 4
Warum der Westen die UN braucht
- Artikel 5
Der Ukrainekrieg hätte verhindert werden können
Artikel 6
- Ist das wiedervereinte Deutschland erneut auf dem Kriegspfad?
ANNEX
1
Nie wieder Krieg!
Die Charta der Vereinten Nationen
„Wir, die Völker der Vereinten Nationen (sind) fest entschlossen,
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren
Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat,
unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der
menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von
allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen, …
Mit diesen einfachen, aber tief bewegenden und für die Zukunft der Menschheit so unendlich
wichtigen Worten beginnt die Präambel der Charta der Vereinten Nationen, die vor 80 Jahren
verfasst wurde. Die Unterzeichner, die sich 1945 in San Francisco zusammenfinden, sind sich einig: Nach zwei verheerenden Weltkriegen sollen nun die Würde des Menschen,
freundschaftliche Beziehungen zwischen den Völkern und eine Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten im Mittelpunkt des politischen Handelns stehen. Und vor allem soll es von nun an keine Kriege mehr geben – weder Präventivkriege noch Angriffskriege. auch der über
Jahrhunderte gültige Unterschied zwischen „gerechten“ und „ungerechten“ Kriegen wird von
der Charta nicht mehr gemacht. Eben keine Kriege!
Alle Mitgliedstaaten stehen nun gleichermaßen in der Verpflichtung, ihre Streitigkeiten und Konflikte ausschließlich durch Verhandlungen zu lösen und einen friedlichen Ausgleich ihrer Interessen zu suchen – ohne Gewalt anzudrohen oder gar anzuwenden. Das gilt
selbstverständlich auch für bereits ausgebrochene Kriege. „Lasst uns miteinander reden und
nicht aufeinander schießen“ und „lasst uns zusammenarbeiten und einander nicht feindlich
gegenüberstehen“ – das sind die Kernbotschaften der Charta der Vereinten Nationen.
Heute haben 193 Staaten die UN-Charta nicht nur unterzeichnet, sondern auch ratifiziert.
Damit sollten die Prinzipien der Charta – ihr Bekenntnis zum Frieden – universelle Geltung
haben, also das Fundament des internationalen Rechts für alle Staaten und alle Menschen dieser Erde bilden. Doch dem ist nicht so – vor allem nicht in den westlichen Ländern. Statt die Prinzipien der Charta hochzuhalten und zur Konfliktlösung auf Diplomatie zu setzen, beginnt man, uns auf einen nahenden Krieg einzustimmen. Si vis pacem, para bellum – „Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor“ heißt die Parole. Von der UN-Charta wird kaum noch gesprochen – und wenn doch, dann oft nur, um Kriege wie den seit über dreieinhalb Jahren andauernden Ukraine-Krieg zu rechtfertigen. Man kann keinen so langen Krieg mit einer Charta rechtfertigen, die „Nie wieder Krieg“ und die Würde des Menschen auf ihre Fahnen geschrieben hat!
Angesichts der erschreckenden Entwicklung immer zerstörerischer Waffensysteme in einer
Welt, in der Sicherheit mit dem Besitz von Atomwaffen verwechselt wird, sollten wir uns
wieder an die UN-Charta erinnern. Ja, sie ist heute von noch größerer Bedeutung als in der
Zeit, als sie unmittelbar nach den Weltkriegen geschrieben wurde. Fanden in den drei
Jahrzehnten der beiden Weltkriege rund 80 Millionen Menschen den Tod, könnte ein Dritter
Weltkrieg in nur wenigen Minuten die gesamte Menschheit und alles Leben auf der Erde
auslöschen.
2
Die Leitsätze der UN-Charta – „Nie wieder Krieg“ und der Erhalt der „Würde des Menschen“
– gewinnen dadurch an noch größerer Bedeutung. Wir werden diese Leitsätze der UN-Charta
dringend benötigen, wenn diese Kriege hoffentlich einmal vorbei sind und sich die
verantwortlichen Politiker zusammensetzen, um eine zukünftige globale Sicherheitsordnung
zu vereinbaren.
Gerade in unserer heutigen Zeit ist es eine Herausforderung, sich für Frieden, Dialog und
Verständigung starkzumachen. Wer sich für diplomatische Lösungen einsetzt, wird oft als naiv belächelt oder gar diffamiert – als „Appeaser“ oder gar als Sprachrohr fremder Interessen dargestellt. Es braucht Mut, sich dem Zeitgeist entgegenzustellen.
Dieses Buch wendet sich an Menschen, die an die Kraft des Völkerrechts glauben und die
Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen (UN-Charta) verteidigen – auch wenn sie dafür
als weltfremd gelten. Letztlich sind jene, die „Kriegstüchtigkeit“ und Aufrüstung als Lösungen ansehen, weltfremd. Nachhaltige Sicherheit und ein dauerhaft friedliches Zusammenleben lassen sich nicht durch immer mehr Waffen, sondern nur durch gegenseitige Verständigung erreichen.
In dieser Broschüre haben wir sechs Artikel zusammengestellt, die verschiedene Aspekte der
UN-Charta beleuchten. Da die Artikel 3, 4 und 5 bereits früher verfasst und veröffentlicht
wurden, kommt es stellenweise zu Wiederholungen in den Argumenten. Die Artikel können
dadurch aber auch unabhängig voneinander gelesen werden.
1. Frieden als Schicksalsfrage der Menschheit
Warum das internationale Recht an Bedeutung verloren hat – und welche
geopolitischen Entwicklungen eine Rückbesinnung auf die UN-Charta dringend
erforderlich machen.
2. Verhandeln und nicht schießen
Eine Analyse der Kriege wischen Russland und Ukraine sowie zwischen Israel und
Iran – und wie die Verweigerung von Verhandlungen zu Krieg und Eskalation geführt
haben.
3. Eine auf der UN-charta aufbauende zukünftige Weltfriedensordnung
Warum eine neue Friedensordnung auf der UN-Charta basieren muss – und weshalb
es dazu keine Alternative gibt.
4. Warum der Westen die UN-Charta braucht
Eine kritische Betrachtung der „regelbasierten Ordnung“ und ein Plädoyer für die
Rückkehr zum Völkerrecht – auch im Interesse westlicher Staaten.
5. Die UN-Charta und der Ukrainekrieg
Eine Untersuchung der Ursachen des Ukrainekriegs – und wie die strikte Einhaltung
der UN-Charta ihn möglicherweise hätte verhindern können.
6. Deutschlands Spiel mit dem Krieg
Eine Analyse des ambivalenten Verhältnisses Deutschlands zur UN-Charta – und der
Risiken, die daraus entstehen.
3
Artikel 1
Krieg und Frieden - die Schicksalsfrage der Menschheit
Die Frage von Krieg und Frieden – also die Frage, ob ein Frieden nur durch militärische Stärke und, falls notwendig, auch durch Kriege herbeigeführt werden müsse oder ob er doch über friedliche Konfliktlösungen wie durch Verhandlungen und Diplomatie gewährleistet werden kann – hat angesichts der wiedererstandenen Feindbilder, der massiven
Aufrüstungsbemühungen und vor allem des Ukrainekriegs und der Kriege Israels eine
entscheidende Bedeutung gewonnen.
Haben also jene recht, die diese Frage mit dem alten römischen Spruch beantworten: „Wenn
du den Frieden willst, bereite den Krieg vor“? Oder sollte nicht vielmehr für uns alle der Aufruf aus der Präambel der Charta der Vereinten Nationen gelten: „Wir, die Völker der Vereinten Nationen (sind) fest entschlossen, künftige Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren …“?
Letztlich geht es um die grundlegende Frage, ob die Entwicklung von Waffensystemen mit
immer größerer Zerstörungskraft oder eher das auf der Charta der Vereinten Nationen
basierende Völkerrecht dazu beitragen kann, Frieden in der Welt zu schaffen und dauerhaft zu sichern. Wir stehen damit erneut vor einer der zentralen ethisch-politischen Fragen der
Menschheitsgeschichte: Frieden durch Abschreckung und Gewalt – oder durch allgemeines
Recht und internationale Kooperation. Angesichts der rasanten Entwicklung von
Massenvernichtungswaffen erhält die Beantwortung dieser Frage eine überlebenswichtige
Bedeutung für die gesamte Menschheit.
Der gefährliche Hang zur militärischen Gewalt
Heute scheint in den westlichen Ländern diese Frage entschieden zu sein. Mehr als jemals seit dem Ende des Kalten Krieges – ja, vielleicht sogar mehr als seit dem Ende der beiden
Weltkriege – hat sich dort die erschreckende Überzeugung durchgesetzt, dass Frieden nur
durch die Androhung oder gar den Einsatz von Waffen verteidigt werden könne. Hingegen
haben die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, die als für alle Staaten gleichermaßen anzuwendende Grundlage für Konfliktlösungen gelten, nahezu vollständig an Bedeutung verloren. Dies hat wiederum zur Erosion des auf der UN-Charta basierenden Völkerrechts geführt.
Diese besorgniserregende Entwicklung – weg vom Völkerrecht hin zu militärischer Gewalt –
zeigt sich besonders deutlich in den beiden derzeit dominierenden zwischenstaatlichen
Konflikten: dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und dem Krieg Israels gegen den Iran.
Beide sind die ersten Auseinandersetzungen seit dem Abwurf der Atombomben am Ende des
Zweiten Weltkriegs, in denen Nuklearwaffen wieder eine strategische Rolle spielen und den
Ausgang der Kämpfe maßgeblich beeinflussen. In beiden Kriegen wäre also das undenkbare
denkbar: der Einsatz von Atomwaffen. Heute existieren weltweit über 12.000 Atomwaffen,
von denen einige bis zu 80-mal stärker sind als jene, die auf Hiroshima abgeworfen wurden.
Damit geht von diesen beiden Kriegen eine bislang nie dagewesene Gefahr für die gesamte
Menschheit aus.
4
Ein entscheidender Aspekt bei der Einschätzung der Risiken ist, dass sich in beiden Kriegen militärische Niederlagen für die strategischen Partner des Westens, der Ukraine und Israels, abzeichnen. Diese Niederlagen würden zudem in eine Zeit fallen, in der sich mit dem zunehmend selbstbewussten Auftreten der BRICS-Plus-Staaten und der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) eine fundamentale geopolitische Verschiebung vollzieht – politisch, wirtschaftlich und technologisch. Diese Niederlagen stehen daher für den zunehmenden Zerfall der einstigen weltpolitischen Dominanz des Westens und einer vom Westen propagierten regelbasierten internationalen Ordnung.
Die zentrale Frage lautet daher: Wird der Westen – insbesondere die NATO-Staaten – die
geopolitischen Veränderungen und den Verlust ihrer einst dominierenden Rolle akzeptieren
oder versuchen, diese durch militärische Eskalation aufzuhalten? Letzteres würde die Welt
gefährlich nahe an einen nuklear geführten Dritten Weltkrieg bringen. Könnten wir uns aber
angesichts dieser Bedrohung doch wieder auf das Friedensgebot der UN-Charta besinnen und
versuchen, beide Konflikte durch Verhandlungen zu lösen?
Trotz berechtigter Kritik an seiner Entscheidungsfindung sind die diplomatischen
Bemühungen von Präsident Trump – insbesondere sein Treffen mit Präsident Putin in Alaska
– ein Hoffnungsschimmer. Dass hingegen viele europäische NATO-Staaten weiterhin auf
Konfrontation setzen und Trumps Friedensinitiativen im Ukrainekrieg zu untergraben
versuchen, erscheint angesichts der unmittelbaren Bedrohungslage für Europa schwer
nachvollziehbar. Denn insbesondere bei einer nuklearen Eskalation der Kriege könnte der
europäische Kontinent zum Schlachtfeld werden. Da würde eine Hochrüstung auch nicht
helfen. Wäre es hier nicht sicherer, doch den in der UN-Charta geforderten Verhandlungsweg
zu nehmen?
Die Zerrüttung des Völkerrechts
Die geopolitischen Entwicklungen der letzten Jahre werfen die Frage auf, ob ein allgemein
anerkanntes und wirksam angewandtes Völkerrecht – basierend auf dem Friedensgebot der
UN-Charta – überhaupt noch existiert. Die ernüchternde Antwort: wohl kaum.
Während die UN-Charta im Kalten Krieg weitgehend blockiert war, wurde sie nicht
grundsätzlich in Frage gestellt. Sie trug dann auch zur Entspannungspolitik der 1970er und
1980er Jahre wie zur Schlussakte von Helsinki (1975) und den vielen
Rüstungskontrollverträgen und den Aufbau von vertrauensbildenden Maßnahmen bei. 1990
ermöglichte der UN-Sicherheitsrat sogar kollektive militärische Maßnahmen unter Artikel VII der UN-Charta zur Befreiung Kuwaits. Solche Kooperationen erscheinen heute undenkbar.
Der Zerfall der UN-Charta begann mit der Missachtung des Gewaltverbots und der Umgehung
des alleinigen Rechtes des UN-Sicherheitsrates über militärische Maßnahmen zu entscheiden.
Damit wurde das kollektive Sicherheitssystem der UN de-facto außer Kraft gesetzt. Immer
häufiger griffen Staaten – direkt oder indirekt – militärisch in andere Länder ein, wenn es ihren Interessen diente. Das betrifft Russland und Israel ebenso wie viele andere Staaten.
Insbesondere NATO-Staaten intervenierten wiederholt militärisch ohne UN-Mandat: ob in
Jugoslawien (1999), Irak (2003), Libyen (2011), Syrien (2017/18) oder durch Einflussnahme
in der Ukraine seit 2014. Laut dem US-Kongress intervenierten die USA zwischen 1992 und
2022 in 251 Fällen militärisch in Drittstaaten. Auch sind Sanktionen gegen Drittstaaten, extra-legale Tötungen oder gar ein Kopfgeld auf einen Präsidenten eines anderen Landes ohne UN-
5
Mandat kaum mit der UN-Charta vereinbar. Wir rutschen so in eine Welt, in der nur das Recht des Stärkeren gilt – genau das, was durch das Völkerrecht verhindert werden sollte.
Besonders gravierend ist das Vorgehen Israels in Gaza und der Westbank, das fundamentale
Normen der UN-Charta und der Vierten Genfer Konvention in einer Form eklatant verletzt,
wie wir das seit den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs in der westlichen Welt nicht mehr
gekannt haben. Dass diese mit westlichen Waffen begannen und weitestgehend stillschweigend
geduldet werden, wirft einen zutiefst dunklen Schatten über die westliche Welt und entlarvt die Doppelmoral einer angeblich auf liberalen Werten und Menschenrechten basierenden regelbasierten internationalen Ordnung.
In den 1980er- und frühen 1990er-Jahren waren Rüstungskontrollabkommen und
vertrauensbildende Maßnahmen entscheidende Schritte, um die Gefahr eines erneuten
Weltkriegs zu bannen und die Welt friedlicher zu gestalten. Diese Vereinbarungen wurden im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen durch Verhandlungen zwischen Gegnern
erreicht – nicht durch die Androhung von Gewalt. Heute sind alle dieser Abkommen, mit der
Ausnahme des Atomwaffensperrvertrages und des Neu START-Vertrages, von den USA
einseitig gekündigt, nicht verlängert oder nicht ratifiziert worden – und das bei gleichzeitig rasanter Entwicklung immer zerstörerischer Waffensysteme. Auch Neu START läuft Ende 2025 aus. Bleibt dann nur der uneffektive Atomwaffensperrvertrag übrig, der kaum ein Land von einer atomaren Bewaffnung abhalten kann?
Nun haben einige europäische Staaten sogar angekündigt, aus der erst 1997 verabschiedeten
Ottawa-Konvention zum Verbot von Antipersonenminen auszutreten. Als Begründung wird
die russische Bedrohung angeführt. Viele erinnern sich noch an Prinzessin Diana, deren
Engagement gegen diese besonders für Zivilisten gefährliche Waffe weltweit große
Anerkennung fand. Das zeigt, wie sehr wir in nur wenigen Jahren vom Weg zu einer
friedlicheren Welt abgekommen sind.
Um eine friedliche Zukunft für den durch den Kalten Krieg zerrissenen europäischen Kontinent zu ermöglichen, wurden mehrere auf der UN-Charta basierende Vertragswerke geschaffen – darunter die Schlussakte von Helsinki (1975), die Charta von Paris für ein neues Europa (1990), die Europäische Sicherheitscharta (1999) sowie der Zwei-plus-Vier-Vertrag (1990), der den Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands ebnete. Doch wer spricht heute noch von ihnen? Wer erinnert sich daran, dass sich einst alle europäischen Staaten darauf geeinigt hatten, ein gemeinsames Europa und ein gemeinsames Sicherheitssystem aufzubauen – basierend auf dem Prinzip, Sicherheit nicht auf Kosten anderer Staaten zu suchen? In diesen Dokumenten war von einer NATO, die heute vorgibt, Sicherheit in Europa zu gewährleisten, keine Rede.
Die UN-Charta betont bereits in ihrer Präambel, dass „die Achtung vor den Verpflichtungen
aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts“ eine Grundvoraussetzung für Frieden
ist. Frieden basiert auf gegenseitigem Vertrauen – gegenseitiges Misstrauen hingegen ebnet
den Weg zu Konflikten. Wenn nun die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
und der ehemalige französische Präsident François Hollande rückblickend einräumen, dass das Minsk-II-Abkommen vor allem dazu diente, der Ukraine Zeit zur Stärkung ihrer Verteidigung zu verschaffen, wirft das Fragen zur Aufrichtigkeit der Verhandlungsführung auf.
Es gibt sehr viele andere Beispiele in denen Verträge nicht eingehalten werden und so
Vertrauen verspielt wird. Ein verlorenes Vertrauen erschwert dann die Lösung internationaler Konflikte – nicht nur in der Ukraine.
6
Warum brauchen wir wieder ein Völkerrecht, das auf der UN-Charta aufbaut?
In einer Welt, die von immer neuen, immer zerstörerischeren Waffensystemen geprägt ist, stellt sich eine scheinbar naive Frage: Was vermögen Worte gegen Raketen? Was kann eine Charta gegen Hyperschallwaffen, Drohnenschwärme und nukleare Abschreckung ausrichten?
Doch gerade diese Frage ist heute relevanter denn je. Denn wenn wir im 21. Jahrhundert, in
dem die Welt durch Technologie, Handel und Kommunikation enger zusammenrückt,
weiterhin auf das Prinzip „Si vis pacem, para bellum“ – „Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor“ – setzen, erhöhen wir nicht unsere Sicherheit, sondern riskieren unsere gemeinsame Zukunft.
Hier sind fünf Gründe, warum wir dringend zu einem Völkerrecht zurückkehren müssen, das
auf der Friedensbotschaft der UN-Charta basiert – und warum die Charta über die Auffassung, dass ein Frieden nur über Kriegsvorbereitungen zu erreichen sei, triumphieren sollte:
(1) Hochrüstung schafft keine Sicherheit
Im Europäischen Parlament rechtfertigte der EU-Kommissar für Verteidigung, Andrius
Kubilius, die im Weißbuch der Kommission vorgesehene Militarisierung der EU mit „Si vis
pacem, para bellum“. Doch wenn dieser Satz zum Leitmotiv aller Staaten werden würde, droht
eine Spirale der Aufrüstung: Jede Aufrüstung eines Staates provoziert eine stärkere Aufrüstung
der anderen.
Das Ergebnis wäre eine Welt, in der immer mehr Länder nach nuklearer Bewaffnung streben
– nicht aus Aggression, sondern aus Angst. Nordkorea dient als Beispiel: Durch eigene
Atomwaffen ist das Regime heute nahezu unangreifbar. Sollte der Iran nach dem israelischen
Angriff ebenfalls nuklear aufrüsten, könnten Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten oder die
Türkei folgen. Auch in Deutschland wird heute über eigene Atomwaffen diskutiert. Und was
wäre dann mit Italien und Polen, oder gar Japan, Südkorea, Australien? Ja, und was würde
passieren, wenn auch die Ukraine oder Taiwan nuklear aufrüsteten? Kaum auszudenken!
Eine Welt mit 50 oder mehr Nuklearmächten wäre keine sichere Welt. Sie wäre ein Pulverfass, in dem ein einziger Funke genügen könnte, um eine globale Katastrophe auszulösen.
Im Übrigen stammt dieser Spruch vom römischen Militärschriftsteller Vegetius, der gegen
Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. lebte – also in der Spätphase des Weströmischen Reiches.
Seine Mahnung, sich für den Frieden kriegerisch zu rüsten, hat Rom jedoch nicht vor dem
Untergang bewahrt. Vielleicht sollte gerade das eine Lehre für uns sein, statt die EU durch unsinnige Militarisierung und Kriegsrhetorik zu gefährden.
(2) Die Welt ist zu klein für heutige Kriege
Die Entwicklungen moderner Waffensysteme machen Kriege durch das gegenseitige
Zerstörungspotenzial zunehmend unmöglich. Bereits während des Kalten Krieges schreckte
man vor einem Atomkrieg aufgrund der „gegenseitig gesicherten Zerstörung“ zurück – eine
Abschreckung, die damals auf nur zwei Supermächte, die USA und die Sowjetunion,
beschränkt war.
7
Heute sind Atomwaffen und die dazugehörigen Raketensysteme für deutlich mehr Staaten
zugänglich. Und nicht nur das: Es existieren inzwischen Waffensysteme, deren
Zerstörungskraft alles übersteigt, was es im Kalten Krieg gab. Dazu zählen „intelligente“
Atomwaffen, Hyperschallraketen und Tarnkappentechnologien, mit denen gegnerische Ziele
in kürzester Zeit präzise und unentdeckt getroffen werden können.
Hinzu kommen neue Kriegskategorien wie der Cyberkrieg und der Krieg im Weltraum, bei
denen künstliche Intelligenz zunehmend menschliche Entscheidungen ersetzt. Unter diesen
Bedingungen kann kein Staat mehr einen Sieg erwarten. Man könnte beinahe hoffen, dass sich
solche Waffensysteme durch ihre eigene Bedrohlichkeit eines Tages selbst abschaffen.
(3) Die Kriegshysterie ist ein westliches Phänomen
Eine wahre Kriegshysterie hat die westliche Welt ergriffen – insbesondere die europäischen
NATO-Staaten. Wer in Deutschland, Frankreich, Schweden usw. lebt, wird von Politikern und
Medien fortwährend auf eine angeblich immanente Kriegsgefahr hingewiesen. Es wird
behauptet, nur konsequente Aufrüstung und eine gesteigerte Kriegstüchtigkeit könnten uns vor den Diktaturen Russlands, Chinas, Irans oder gar Nordkoreas retten.
Man spricht davon, dass es in fünf Jahren, vielleicht sogar schon in drei Jahren, zu einem Krieg kommen werde. Die Streitkräfte müssten daher unbedingt aufgestockt werden. Schon heute machen die Verteidigungsausgaben der NATO rund 55 % der weltweiten Militärausgaben aus – verglichen mit geschätzten 13 % von China, 6 % von Russland und 3,5 % von Indien.
Mit den nun von NATO-Mitgliedsländern beschlossenen Erhöhungen ihrer nationalen
Verteidigungsbudgets auf 5 % des Bruttoinlandsprodukts würden sich die
Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten nochmals verdoppeln. Die NATO, deren
Bevölkerungsanteil weltweit etwa 10 % beträgt, könnte im Jahr 2035 über 70 % (oder mehr)
aller globalen Militärausgaben kontrollieren. Wie ist das gegenüber der 90% der
Weltbevölkerung zu rechtfertigen?
Diese Fragen stellen sich vor allem vor dem Hintergrund, dass konkurrierende Staatensysteme wie BRICS+ oder die SCO, die den NATO-Staaten nicht nur demografisch, sondern auch zunehmend wirtschaftlich und technologisch den führenden westlichen Wirtschaftsmächten der G-7 überlegen sind, bislang keine vergleichbare Militärallianz aufgebaut haben. Wie können wir ständig von einer Kriegsgefahr sprechen und gleichzeitig einen Großteil der Welt als Feinde betrachten?
Sollte die militärische Überlegenheit des Westens nicht vielmehr die Flexibilität bieten, auf andere Staatengruppen zuzugehen und mit ihnen über ein globales Sicherheitssystem zu
verhandeln? Wäre es nicht jetzt verantwortungsvoll, wieder über Rüstungskontrolle und
vertrauensbildende Maßnahmen zu sprechen?
(4) Eine Welt im Umbruch
Ein Grund, warum es so schwer ist, eine Lösung für die aktuellen Kriege zu finden, liegt
offenbar in der enormen Geschwindigkeit, mit der geopolitische Veränderungen derzeit
voranschreiten. Denn unser Denken und unsere Haltung gegenüber diesen Konflikten sind
weiterhin davon geprägt, dass die westliche Welt die dominierende Kraft auf dem Globus sei
– eine Kraft des Guten, wie wir glauben, die im Gegenzug für ihren Führungsanspruch dem
8
Rest der Welt Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie ein liberales und damit erfolgreiches
Wirtschaftssystem anbietet.
Und tatsächlich: Die westliche Welt war in den vergangenen 250 Jahren – manche würden
sagen, sogar noch viel länger – die wirtschaftlich, technologisch und militärisch führende
globale Macht. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts und der Sowjetunion in den
1990er-Jahren schien sich diese Dominanz noch einmal zu bestätigen. Und plötzlich ist all das vorbei.
Noch vor vier Jahren beschrieben wir Russland mit dem McCain Zitat abwertend als eine
„Tankstelle, die sich als Land ausgibt“. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, war man sich sicher, dass dieses Russland gegen eine mit westlichen Waffen ausgestattete Ukraine eine krachende Niederlage erleiden müsse. Und nun?
Noch vor einem Jahr hielten wir Israel unter seinem Eisernen Dom für unbesiegbar, während
unser Bild vom Iran weitgehend von Karikaturen schmuddeliger „Mullahs“ geprägt war. Doch
es war Israel, das – getroffen von iranischen, zielgenauen Raketen – um einen Waffenstillstand ersuchte.
Diese Niederlagen sind Anzeichen dafür, dass sich die Welt in nur wenigen Jahren grundlegend verändert und zu fundamentalen geopolitischen Umbrüchen geführt hat, die alle Bereiche der internationalen Ordnung erfasst haben – seien sie demografisch, wirtschaftlich, technologisch oder sicherheitspolitisch. Daran wird der Westen nichts mehr ändern können.
So ist eine multilaterale Ordnung im Entstehen, in der der Westen seine Macht mit anderen
Machtzentren teilen muss. Westliche Akteure wie die USA und die Europäische Union werden
künftig nur noch zwei unter mehreren Machtzentren sein – und dabei vielleicht nicht einmal
mehr die stärksten. Der Westen muss nun lernen, diese neuen Realitäten anzuerkennen und
sich bescheidener und kooperativer als bisher aufzustellen. Wie schwer das ist, wissen wir alle aus unseren persönlichen Erfahrungen.
Die BRICS-Staaten sowie die SCO betonen immer wieder die zentrale Rolle der UN-Charta in
einer zukünftigen multipolaren Welt und einer internationalen Ordnung, die auf deren
Prinzipien basiert: friedliche Koexistenz und Vermeidung von Kriegen, das Recht auf soziale und wirtschaftliche Entwicklung, gleiche Souveränität und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Das sind doch alles Werte der UN-Charta, die einst ihren Ursprung in westlichen Gesellschaften hatten. Warum sollten wir sie also als Feinde betrachten?
Liegt hierin nicht sogar eine einzigartige Chance für die USA und die EU, mit den BRICS-
Staaten, der SCO und anderen regionalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um eine auf
der UN-Charta basierende kollektive Sicherheitsstruktur gleichberechtigter Staaten
aufzubauen? Der Westen hat doch keine Alternative.
(5) Welches Menschenbild haben wir von uns selbst?
Aber vielleicht ist es das Menschenbild, das wir von uns selbst haben – und das wir immer
wieder erneuern und fördern sollten –, das den tieferen Grund dafür bildet, warum wir
zurückkehren sollten zu einer Welt, in der friedliche Beziehungen zwischen Staaten und deren
9
Bürgern durch die Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeinen Menschenrechte und das
daraus entstandene Völkerrecht aufgebaut werden.
Wenn ein EU-Kommissar die europäische Sicherheitspolitik mit den Worten „Si vis pacem,
para bellum“ beschreibt, ohne auch nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, Sicherheit durch Dialog und gegenseitiges Entgegenkommen zu erreichen, geht er von einem ausgesprochen negativen Menschenbild aus. In diesem wird jeder dem anderen zum Feind, und menschliche Gesellschaften entstehen, deren Beziehungen – sowohl nach innen als auch nach außen – durch Gewalt bestimmt werden und wiederum nur durch Gewalt oder deren Androhung kontrolliert werden können.
Während Hobbes mit dem „Krieg aller gegen alle“ lediglich den Naturzustand des Menschen
beschreibt, geht die EU einen erschreckenden Schritt weiter und überträgt dieses Bild auf die gesamte menschliche Zivilisation und die Staatengemeinschaften. Wie kann eine Institution wie die EU, die einst als Friedensprojekt gegründet wurde, in derartige Tiefen der Verachtung gegenüber dem Menschen und seiner Zivilisation verfallen?
Demgegenüber ist der vielleicht erstaunlichste und berührendste Aspekt der UN-Charta, dass
sie – nach den menschlichen Abgründen mit Millionen von Kriegsopfern und dem
millionenfachen Mord an unbewaffneten Menschen im Namen des Rassenwahns Nazi-
Deutschlands und der Überlegenheitsideologie Japans – auf einem ausgesprochen positiven
Menschenbild aufbaut.
Indem die Charta alle Mitgliedsstaaten dazu auffordert, ihre Konflikte friedlich zu lösen, geht sie davon aus, dass dies nicht nur erstrebenswert, sondern auch möglich ist. Sie basiert auf dem Bild eines vernunftbegabten, empathiefähigen und sozial verantwortlichen Menschen – eines Menschen, der mit allen anderen Menschen unabhängig seiner ethnischen oder religiösen Identitäten gleiche Rechte und Pflichten sowie das Streben nach Frieden teilt. So sollten auch die Prinzipien der UN-Charta die Leitfäden für alle Menschen sein, die sich für Frieden einsetzen. Deshalb beginnt die Charta auch mit den Worten:
Wir die Menschen
10
Artikel 2
Verhandeln und nicht Schießen
Wie unterscheiden sich die Kriege Russlands und Israels aus der Perspektive der UN-Charta?
Die Charta der Vereinten Nationen (UN) verbindet das Verbot militärischer Gewalt zur
Durchsetzung politischer Ziele mit dem Gebot, Konflikte auf friedlichem Wege zu lösen. Ein
bloßes Verbot militärischer Gewalt zur Konfliktlösung würde auch keinen Sinn ergeben, denn
Konflikte zwischen Staaten wird es immer geben – und diese müssen gelöst werden. Wenn
nicht durch Gewalt, dann eben durch Verhandlungen.
Daher haben sich in der UN-Charta alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre Konflikte
ausschließlich durch Verhandlungen zu lösen und auf die Anwendung von Gewalt zu
verzichten. In diesem Beitrag wollen wir zwei Kriege im Hinblick auf diese Kernaussage der
UN-Charta untersuchen: Russlands Angriff auf die Ukraine 2022 und Israels Angriff auf den
Iran im Sommer 2025.
Die Kernfragen, die wir uns stellen müssen, sind folgende: Ist es zu diesen beiden Kriegen
gekommen, weil die Diplomatie versagt hat, und welche der Kriegsparteien ist ihren
Verpflichtungen aus der UN-Charta, Konflikte friedlich zu lösen, nicht nachgekommen? Um
diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns das Verhalten sämtlicher Akteure ansehen, also
nicht nur der Kriegsparteien Russland und Israel, sondern auch der Ukraine der NATO, der EU, der USA, einer Reihe an europäischen Staaten sowie des Iran.
Konflikte durch Verhandlungen zu lösen ist die eigentliche Aufgabe der Diplomatie. Betrachtet man jedoch den Ukrainekrieg und Israels Krieg gegen den Iran, so zeigt sich ein eklatantes Versagen der Diplomatie. Wer die Reden vieler der jeweiligen Außenminister in den letzten drei Jahren verfolgt hat, gewinnt den Eindruck, dass sie sich eher als Fürsprecher militärischer Gewalt denn als Vermittler diplomatischer Lösungen verstanden haben. Eine Kursänderung zumindest im Ukrainekrieg erfolgte in den USA erst mit der Amtsübernahme von Präsident Trump.
Zum UN-Charta-Verbot der Anwendung militärischer Mittel
In beiden Kriegen rechtfertigen Russland und Israel ihre militärischen Angriffe auf die Ukraine bzw. den Iran als Präventionskriege. Russland argumentiert, mit seiner Intervention in der Ukraine eine Ausweitung der NATO bis an seine Grenzen verhindern zu wollen. Israel begründet seinen Angriff auf den Iran mit dem Ziel, den Bau einer Atombombe durch den Iran zu verhindern. Beide Staaten berufen sich auf eine angeblich existentielle Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit. Die angegriffenen Staaten – die Ukraine und der Iran – entgegnen hingegen, dass von ihnen keine solche Gefahr ausgehe.
Völkerrechtlich ist die Lage eindeutig: Die UN-Charta erlaubt keine Präventionskriege – es sei denn, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hätte diese autorisiert. Das ist nicht geschehen, und daher sind beide militärischen Angriffe auf einen anderen Staat nach internationalem Recht illegal – ebenso wie die amerikanischen Bombardierungen iranischer Nuklearanlagen. Die von Russland und Israelvorgebrachten Gründe, es handle sich um existenzielle Bedrohungen,
11
spielen dabei keine Rolle. Die Entscheidung darüber, ob eine Gefährdung des internationalen Friedens vorliegt und ob dies ein militärisches Eingreifen rechtfertigt, obliegt dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN). In beiden Fällen jedoch war der UN-Sicherheitsrat durch die jeweiligen Vetos Russlands bzw. der USA blockiert.
Aus dem Artikel VI – Friedliche Beilegung von Streitigkeiten (Konflikten) ergibt sich, dass die Konfliktparteien sich um eine Lösung der Konflikte bemühen sollen, die zum Krieg geführt haben. Die Forderung der EU und des Vereinigten Königreich, keine Verhandlungen, sondern ausschließlich einen Waffenstillstand zu fordern entspricht nicht dem Geist der Charta.
Selbstverständlich geht es darum, dass die Waffen schweigen. Doch ohne eine Lösung des
zugrunde liegenden Konflikts bliebe dieser bestehen – und damit auch die Gefahr eines
erneuten Krieges. Erst wenn Verhandlungen nicht zum Erfolg führen, kann der Sicherheitsrat
nach Artikel VII weiterführende Maßnahmen wie Sanktionen bis hin zu militärischen
Maßnahmen autorisieren. Eine friedliche Konfliktlösung hat aber immer Vorrang.
In Deutschland wird fälschlicherweise oft, statt von den Ursachen, von einer „Vorgeschichte“ des Krieges gesprochen. Dadurch entsteht die Tendenz, den Krieg von den Ursachen zu trennen, die zu ihm geführt haben. Das verführt dann dazu, den Krieg ausschließlich unter moralischen Gesichtspunkten zu betrachten. Dabei wird – vielleicht sogar absichtlich – vergessen, dass Kriege zwar immer unmoralisch sind, es bei ihnen jedoch nicht um Moral, sondern um gegensätzliche Interessen geht.
In diesem Zusammenhang muss man auch die im Westen häufig wiederholten Hinweise auf
Artikel 51 der UN-Charta zur Rechtfertigung der militärischen und finanziellen Unterstützung der Ukraine zur Fortsetzung des Krieges verstehen. Es stimmt: Nach Artikel 51 der Charta hat jedes Land im Falle eines Angriffs das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Man kann aber nicht mit einer Charta, die für „Nie wieder Krieg“ steht, einen mittlerweile seit dreieinhalb Jahren andauernden Krieg, der massiv ohne Autorisierung durch die UN von der NATO und ihren Mitgliedstaaten unterstützt wird, rechtfertigen.
Artikel 51 entbindet keine der beiden Konfliktparteien von ihrer Verpflichtung,
schnellstmöglich eine friedliche Lösung zu suchen. Die Tragik dieses schrecklichen Krieges
liegt darin, dass sich Russland und die Ukraine zunächst konform zur UN-Charta verhalten und bereits nach fünf Wochen einen Rahmen für eine Friedenslösung abgesteckt hatten – also eine friedliche Lösung anstrebten. Doch dieser Prozess wurde von der NATO – allen voran den USA und dem Vereinigten Königreich – torpediert.
Zum UN-Charta-Gebot friedlicher Konfliktlösungen
Das Verbot militärischer Gewalt zur Konfliktlösung ist nur ein Aspekt der UN-Charta. Aus ihr ergibt sich zwingend eine zweite, vielleicht sogar wichtigere Perspektive: das Gebot, Konflikte friedlich beizulegen. Wenn man also die Frage stellt, ob sich Russland und Israel vor ihren militärischen Angriffen um eine – wie in der Charta vorgeschrieben – diplomatische Lösung bemüht haben und ob solche Bemühungen diese Kriege voraussichtlich hätten verhindern können, fällt das Urteil im Hinblick auf die Kriege Russlands gegen die Ukraine und Israels gegen den Iran sehr unterschiedlich aus.
12
(i) Russlands abgewiesene Verhandlungsbemühungen
Hätte der Ukrainekrieg durch Verhandlungen verhindert oder zumindest unmittelbar nach
seinem Ausbruch beendet werden können? Die Antwort darauf fällt recht eindeutig mit ja aus.
Bereits seit 1997 – also noch unter Präsident Jelzin – wusste die NATO, dass eine Aufnahme
der Ukraine in die NATO eine der „rotesten Linien“ Russlands überschreiten würde. Dennoch
wurde dieses Ziel weiterverfolgt und beim NATO-Gipfel in Bukarest im Jahr 2008 offiziell
verkündet. Dabei war klar, dass schon die bereits erfolgte Aufnahme einer Reihe von
osteuropäischen Staaten in die NATO den Zusicherungen widersprochen hatte, die der
damaligen Sowjetunion bei den 2 plus 4 Verhandlungen zur Vereinigung der beiden deutschen
Staaten gegeben worden waren und dass die potentielle Aufnahme der Ukraine in das westliche Verteidigungsbündnis von Russland nicht hingenommen werden würde.
Während Deutschland 2008 noch klar gemacht hatte, dass es eine rasche Aufnahme der
Ukraine in die NATO skeptisch sieht und deshalb einer Einleitung des Membership Action
Plans nicht zugestimmt hatte, blieb eine entsprechend klare Reaktion auch nach Aufnahme des NATO-Beitritts als Ziel in die ukrainische Verfassung 2019 aus. Seitdem versuchte Russland wiederholt, den sich abzeichnenden Konflikt durch Verhandlungen mit der NATO zu lösen. Im Juni 2021 kam es zu einem Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Biden in Genf, das jedoch in der Frage der Osterweiterung der NATO ergebnislos blieb. Im Dezember 2021 übermittelte Russland dem US-Präsidenten sowie der NATO-Führung ein schriftliches Verhandlungsangebot, die NATO-Osterweiterung zu stoppen – auch dieses wurde abgelehnt.
Auch spätere Einzelbesuche von Bundeskanzler Scholz und Präsident Macron führten zu
keinem Ergebnis. Keiner der beiden wollte Zusagen in der Frage der NATO-Erweiterung
machen.
Nach dem Ausbruch des Krieges am 22. Februar 2022 ergab sich bereits nach fünf Wochen
eine zweite Möglichkeit, den Konflikt durch eine Verhandlungslösung zu beenden: Am 29.
März 2022 einigten sich ukrainische und russische Unterhändler in Istanbul auf einen
Friedensplan mit zehn Vorschlägen. Diese stammten von ukrainischer Seite und sahen keine
Gebietsverluste vor – lediglich für die Krim war eine Sonderregelung vorgesehen.
Doch schon am 24. März 2022 fand ein Sondergipfel der NATO statt, zu dem sogar Präsident
Biden anreiste. Obwohl alle Beteiligten über die Fortschritte der ukrainisch-russischen
Verhandlungen informiert waren, unterstützten sie diese nicht. Im Gegenteil: Sie lehnten
jegliche Gespräche mit Russland ab, solange sich russische Truppen nicht vollständig aus der Ukraine zurückgezogen hätten.
Präsident Selenskyj versuchte noch eine Zeit lang, die Ergebnisse der Verhandlungen in der
Türkei zu verteidigen, doch der Druck – insbesondere seitens der USA und Großbritanniens –
überwog. Die Gespräche mit Russland wurden eingestellt.
Als im April 2022 der damalige US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Außenminister
Antony Blinken Kiew besuchten, wurde klar, worum es ging: Man wollte Russland eine
schwere Niederlage zufügen, es dauerhaft schwächen und glaubte bereits, den Krieg gewonnen
zu haben. Eine Verhandlungslösung war nicht gewünscht. Denn durch eine russische
Niederlage hätte die NATO die Kontrolle über die Ukraine und das Schwarze Meer erlangt –
ein strategisch bedeutender Faustpfand auch in einer möglichen zukünftigen
13
Auseinandersetzung mit China. In der US-Administration hatten sich diejenigen durchgesetzt, die auf eine Schwächung Chinas durch eine Zerstörung des engsten Verbündeten Pekings, Russland, setzten.
Die Ukraine wurde damit den geopolitischen Interessen der USA und der NATO geopfert. In
den folgenden dreieinhalb Jahren bezahlte sie dafür mit einem sehr hohen Blutzoll.
Die US-Regierung unter Präsident Biden und die britische Regierung unter Premierminister
Johnson haben sich damit eine schwere Schuld aufgeladen. Während inzwischen von der
Trump-Administration der Kurs der Verhandlungen eingeschlagen wurde, weil sie ein Bündnis
zwischen Russland und China als gefährlichste Machtkonstellation gegenüber den USA
einschätzt, hält die EU weiterhin an ihren Maximalforderungen gegenüber Russland fest und
verweigert jegliche Kontakte mit Moskau. Dies stellt eine Verletzung der in der Charta der
Vereinten Nationen geforderten Verpflichtung zu Verhandlungen dar.
(ii) Israels Sabotage von Verhandlungen
Der Iran befand sich mit den USA in Verhandlungen über sein Urananreicherungsprogramm,
als Israel einen Angriff auf den Iran startete und versuchte, das iranische Nuklearprogramm und die militärische Infrastruktur des Landes zu zerstören und damit entscheidende Schritte vorzunehmen, um die dortige Regierung zu stürzen. Doch nicht nur das: Israel versuchte bereits in der ersten Angriffswelle, den Leiter des iranischen Verhandlungsteams gezielt zu töten.
Israels Angriff auf den Iran war nicht nur völkerrechtswidrig, sondern richtete sich offenbar gezielt gegen die in Oman stattfindenden Verhandlungen. Israel wollte offensichtlich nicht einmal die Ergebnisse dieser Gespräche abwarten, sondern nutzte gezielt die Verhandlungen, um einen Überraschungsangriff zu starten und die Verhandler des Iran zu töten.
Damit hat Israel, unterstützt von den USA, nicht nur einen völkerwidrigen Angriffskrieg
unternommen, sondern hat auch noch der aus ihrer Mitgliedschaft in der UN resultierende
Verpflichtung zu verhandeln, den „Krieg“ erklärt.
Dem Iran kann in diesem Zusammenhang keine Schuld nachgewiesen werden. Nicht nur hatte
Teheran die Inspektionen der IAEA akzeptiert, sondern war auch in direkte Verhandlungen mit den USA über sein Atomprogramm eingetreten.
Gewinner und Verlierer
Betrachtet man den Verlauf beider Konflikte, kommt man zu einem bemerkenswerten
Ergebnis: In beiden Fällen sind es die Konfliktparteien, die Verhandlungen abgelehnt haben, die als Verlierer dastehen. Was auch immer noch geschehen mag – eines steht bereits fest: Die NATO hat den Krieg in der Ukraine verloren. Ihr Ziel war es, Russland kleinzuhalten, doch Russland geht aus diesem Krieg als dritte Großmacht neben den USA und China hervor. Im Gegensatz dazu wird die EU extrem geschwächt aus diesem Konflikt hervorgehen. Daran ändern auch Vorbereitungen für eine militärische Auseinandersetzung mit Russland und die Diskussion um die Entsendung von Bodentruppen einer „Koalition der Willigen“ aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien nichts.
Auch im Krieg Israels gegen den Iran besteht kaum ein Zweifel daran, dass Israel als Verlierer dasteht. Wollte Israel den Iran destabilisieren und dessen Fähigkeit zur Entwicklung einer Atombombe dauerhaft zerstören, so ist der Iran heute wohl geeinter als je zuvor. Zudem dürfte
14
der Iran nun alles daran setzen, eine Atombombe zu entwickeln oder zu beschaffen, um so seine eigene Sicherheit zu stärken. Dabei würde er – ähnlich wie Israel – zu einer nicht-deklarierten Atommacht werden. Die Raketentechnologie, um eine solche Atomwaffe präzise auf ein Ziel in Israel zu bringen, ist bereits vorhanden.
Fazit
Verhandlungen mit dem Gegner über bestehende Konflikte lohnen sich – und sind keineswegs
ein Zeichen von Schwäche, wie heute oft behauptet wird. Sie müssen aber ernsthaft und
aufrichtig geführt werden. Die Ablehnung von Verhandlungen ist nicht nur ein Verstoß gegen
die UN-Charta, sondern erweist sich zudem als nachteilig auch für die Konfliktbeteiligten, die die Verhandlungen zurückweisen oder torpedieren.
15
Artikel 3
Die UN-Charta muss das Herz und die Seele jeder neuen Friedensarchitektur sein
Dieser Artikel ist ein Beitrag für die deutsche Friedensbewegung zum diesjährigen Anti-
Kriegstag am 1. September. An diesem Tag vor 84 Jahren überfiel das Deutsche Reich
Adolf Hitlers Polen und entfachte damit den Zweiten Weltkrieg und brachte damit
unbeschreibliches Unglück und Leiden über Europa und die Welt.
Die UN-Charta war der Versuch den beiden wohl schrecklichsten, zerstörerischsten und
mörderischsten Kriegen der Menschheitsgeschichte seit der Zeit der Aufklärung, ein
Friedenskonzept der Menschlichkeit entgegenzustellen. Erforderten der Erste und
Zweite Weltkrieg in heutiger Währung Trilliarden an Dollar, um immer durchtriebenere
Waffensysteme des millionenfachen Tötens zu produzieren und einzusetzen, bestand die
UN-Charta gerade mal aus zwanzig Seiten Papier. Damit stand die Kraft der Worte des
Friedens den Arsenalen an Waffen des Krieges gegenüber – zwei höchst ungleiche
Gegenspieler! Und doch stellen die Prinzipien der UN-Charta und nicht die Apologien
der Kriege und militärischer Siege die wirklichen epochalen Errungenschaften der
Menschheit dar.
Denn als sich im Juni 1945 in San Francisco 50 Repräsentanten der alliierten
Siegernationen trafen, taten sie etwas unglaublich Revolutionäres. Die nach dem
Zweiten Weltkrieg zu entstehende neue Weltordnung sollte nicht mehr, wie noch nach
dem Ersten Weltkrieg, durch einen Siegfrieden bestimmt werden. Von nun an sollte ein
auf gemeinsame Prinzipien aufbauendes kollektives Sicherheitssystem den Weltfrieden
bewahren. Alle Nationen, unabhängig ihrer Größe oder ihrer politischen und
wirtschaftlichen Systeme, würden daran teilnehmen. Der einigende Gedanke war: Nie
wieder Krieg! So ging es in der UN-Charta auch nicht um Rache und Vergeltung und es
wurde nicht mehr zwischen gerechten und ungerechten Kriegen oder Siegern und
Besiegten unterschieden. Konflikte zwischen Staaten sollten nur noch durch
Verhandlungen und nicht mehr durch militärische Gewalt gelöst werden. Die UN-Charta
nahm dadurch beide Seiten eines Konfliktes gleichermaßen in die Verantwortung, eine
friedliche Lösung zu finden.
In der UN-Charta verpflichten sich die Mitgliedsstaaten dann auch zur
Gleichberechtigung aller Nationen, der Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten anderer Staaten, der Einhaltung internationaler Vereinbarungen sowie
zur internationalen Kooperation and gegenseitiger Toleranz. Herkömmliche
Überlegungen Kriege durch militärische Gleichgewichte zu verhindern, gibt es nicht
mehr. Hingegen legt die UN-Charta das Hauptgewicht für den Erhalt eines Friedens auf
fundamentale Menschenrechte und die unantastbare Würde eines jeden Menschen
unabhängig von seiner Herkunft, Geschlecht und Religion und die Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau, sowie auf dem Recht aller Menschen auf sozialen und
wirtschaftlichen Fortschritt.
16
Und doch wurde die UN-Charta fast sofort in Frage gestellt. Nur 20 Tage nach der
Unterzeichnung der UN-Charta am 26. Juni 1945 und wenige hundert Kilometer vom
Tagungsort San Francisco entfernt explodierte in der Wüste von New Mexico die erste
Atombombe. Und noch vor dem Inkrafttreten der UN-Charta am 24. Oktober 1945,
wurden durch den Abwurf von nur zwei Atombomben auf japanische Städte, vielleicht
bis zu einer Viertelmillion Menschen, fast ausschließlich Zivilisten, getötet. Die
Jahrtausende alte Überzeugung, dass nur eine militärische Überlegenheit Sicherheit
garantieren könne, war so mit einer nie dagewesenen Zerstörungskraft wiedererstanden.
Hatten bereits die vorhergegangenen Kriege Weltbrände verursacht, so bestand nun die
Möglichkeit in kürzester Zeit die gesamte Menschheit auszulöschen. Im Kalten Krieg
haben dann auch Atomwaffen und nicht die UN-Charta die internationalen Beziehungen
bestimmt. Die Hoffnung auf einen Frieden, der auf der Zusammenarbeit aller Nationen
aufbaut, wurde durch die Bedrohung einer sich ‚gegenseitig zugesicherten Vernichtung‘
ersetzt.
Die große Tragödie unserer Zeit ist es aber, dass auch mit dem Ende des Kalten Krieges
kein Frieden entstand. Dabei waren die Voraussetzungen dafür ausgesprochen
vielversprechend. Mit der Auflösung des Warschauer Paktes und dem Zusammenbruch
der Sowjetunion im Jahr 1991 gab es keine Feinde mehr. Der Weg zu einem in der UN-
Charta vorgesehenen weltumspannenden Frieden war nun frei. Anfangs schien es auch
so, als im Jahre 1990 die auf der UN-Charta aufbauende Charta von Paris für ein neues
friedliches Europa feierlich beschlossen wurde.
Nur sahen das die Strategen der USA ganz anders. Indem damals Russland im Chaos
versank und China geopolitisch noch keine Rolle spielte, war die USA zur alleinigen
globalen Supermacht aufgestiegen. Bereits im Jahr 1992, also nur einem Jahr nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion, wurde die Wolfowitz Doktrin formuliert, nach der
kein kollektives Sicherheitssystem wie das der UN-Charta, sondern allein die USA,
gestützt auf ihre militärische, wirtschaftliche und technologische Übermacht, die
internationalen Regeln bestimmen und auch durchsetzen solle. Die Idee einer
`regelbasierten Weltordnung`war geboren. Es sollte ein neues ‚amerikanisches
Jahrhundert‘ werden, wobei durch die NATO die europäischen Staaten in dieses Projekt
eingebunden werden würden. So wuchs die NATO von einst 12 auf heute 32
Mitgliedsstaaten und das, obwohl seit der Auflösung des Warschauer Paktes die USA
und ihre Verbündeten keiner militärischen Bedrohung ausgesetzt waren. Der Zweck war
ein anderer: Machterhalt: „Unser erstes Ziel ist, das Wiederauftreten eines neuen Rivalen
auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion oder woanders zu verhindern…und
dies gegeben falls auch militärisch durchzusetzen…“ so in der Wolfowitz Doktrin.
Damit war auch die NATO kein Verteidigungsbündnis mehr, sondern hatte sich in ein
Machtinstrument der Staaten des ‚weißen Nordens‘ unter Führung der USA entwickelt,
eines ‚weißen Nordens‘ der heute mit um die 10% der Weltbevölkerung (und
abnehmend) eine Minderheit ist, aber dennoch das Recht für sich beansprucht, die Welt
militärisch zu dominieren. Die USA allein verfügen heute über ein weltweites Netz von
700 bis 800 amerikanischen Militärbasen. In 2014, war der Anteil der NATO-Staaten an
den weltweiten Militärausgaben 55% – im Vergleich zu China mit 12%, Russland mit
5,5% und Indien mit 3,2% der Weltrüstungsausgaben (SIPRI). War die NATO als
Verteidigungsbündnis noch UN-Charta konform, ist sie das heute als das einzig
bestehende Militärbündnis in der Welt zur Durchsetzung unilateraler
Vormachtansprüche nicht mehr.
17
Es sollte daher nicht wundern, dass sich gegen die NATO zunehmend Widerstand unter
Nicht-NATO Staaten formiert. So ist der Ukrainekrieg, indem es darum geht, eine
weitere Ausweitung der NATO in die Ukraine und Georgien zu verhindern, ein
Ausdruck dieses Widerstands. Das betrifft in erster Linie Russland, erklärt aber auch,
warum es in Asien, in Afrika, dem Mittleren Osten und in Latein Amerika trotz
Russlands illegaler Intervention keine Unterstützung für die westliche Ukrainepolitik
einer NATO Ausweitung gibt.
Die politisch-militärischen Spannungen zwischen den USA und NATO einerseits und
Russland und China anderseits scheinen heute einen Tiefpunkt erreicht zu haben, den
wir so nicht einmal aus den Zeiten des Kalten Krieges kannten. Es gibt eine sich immer
schneller drehende Spirale neuer Sanktionen und Wirtschaftsblockaden. Gleichzeitig
haben die globalen Militärausgaben ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht – und
steigen weiter. Nuklearwaffen werden „modernisiert“, um „intelligenter“ zu werden, und
neue Hyperschall-Raketensysteme und Tarnkappenkampfjets sollen sie „sicher“ ins Ziel
bringen. Es gibt immer mehr autonome Waffensysteme, die ohne menschliches Zutun
operieren und mit Stealth-Technologien und künstlicher Intelligenz ausgerüstet sind.
Auch gibt es Vorbereitungen, zukünftig Cyber- und Weltraumkriege führen zu können.
Wir kommen immer mehr zu einer Situation, in der der Mensch die Kontrolle über
militärische Entscheidungen verlieren könnte.
Wir scheinen gefangen im Wahnsinn des Krieges. Dabei sind die drückenden Probleme
der Menschheit ganz andere: die Erwärmung der Erdatmosphäre, der steigende
Meeresspiegel, die Verwüstung riesiger Regionen, der Mangel an Wasser, und immer
noch eine grassierende Armut und weit verbreitete Unterernährung. Hinzu kommen
anschwellende Flüchtlings- und Migrantenströme, sich ausbreitende Slums, tödliche
Epidemien, begrenzte Rohstoffe und innerstaatliche Konflikte und Gewalt. Keine dieser
Probleme werden wir mit Panzern, Raketenwerfern oder gar Massenvernichtungswaffen
lösen können.
Das Zerstörungspotential moderner Waffensysteme ist inzwischen für unsere immer
enger zusammenrückende Welt viel zu groß geworden, als dass wir rational noch die
Wahl zwischen einer Sicherheit durch Waffen oder einem Frieden durch
Zusammenarbeit hätten. Vielleicht könnten das sinnlose Töten und Zerstören im
Ukrainekrieges der Auslöser dafür sein, uns klar zu werden, dass wir zurück zu einer
Friedensordnung kommen müssen, die nicht auf militärische Überlegenheit und
mächtige Militärblöcke baut, sondern die auf den Prinzipien der UN-Charta beruht.
Die UN-Charta ist und bleibt Ausdruck der Hoffnung der Menschheit auf Frieden. Sie
ist inzwischen von einer Vielzahl an internationalen Konventionen und Vereinbarungen
zu fast allen Aspekten unseres menschlichen Zusammenlebens umgeben, angefangen
von Menschenrechten bis zum Klimaschutz sowie zu faireren humanitären, sozialen und
wirtschaftlichen Beziehungen in der Welt. Ihnen ist gemein, dass sie auf die
Gewaltlosigkeit zwischen Staaten, der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder und
der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung aller Menschen setzen.
So ist das Problem auch nicht die UN-Charta, sondern der Umstand, dass vier der fünf
Vetomächte im UN-Sicherheitsrat, und damit die eigentlichen Garanten der UN-Charta,
die USA, Großbritannien, Frankreich und nun auch Russland, diese wiederholt
18
verletzten und illegale Kriege geführt haben. Diese vier Vetomächte sind alle Staaten
des ‚weißen Nordens‘, drei von ihnen sind sogar führende Staaten der NATO. Um den
zukünftigen Weltfrieden zu sichern, wird sich das ändern müssen. Den Ländern des
‚globalen Südens‘ muss ein größeres Mitsprache- und Entscheidungsrecht im UN-
Sicherheitsrat eingeräumt werden. Eine Konsequenz des Ukrainekrieg ist bereits, dass
sich die globale Position des ‚Globalen Südens‘ verstärkt hat, während der westliche
Drang nach einer von ihnen dominierten Weltordnung zu schwächeln beginnt. Ein
unvorhergesehenes positives Ergebnis des Ukrainekrieges könnte es so sein, dass er zu
einer gerechteren multi-polaren Weltordnung führen wird – einer Weltordnung, für die
die UN-Charta ursprünglich konzipiert war.
Auch der Ukrainekrieg wird eines Tages zu Ende gehen und wir werden uns wieder um
eine neue Friedensordnung bemühen müssen, um „künftige Geschlechter vor der Geißel
des Krieges zu bewahren“. Eine friedliche und faire Welt für die bald 10 Milliarden
Erdbewohner, von denen 9 Milliarden aus dem ‚Globalen Süden‘ kommen werden, muss
auf den Prinzipien der UN-Charta aufgebaut werden. Die UN-Charta muss daher im
Zentrum jeder Friedensbewegung stehen.
19
Artikel 4
Warum der Westen die UN braucht
Dieser Artikel ist 2019 also vor dem Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 geschrieben
worden. Aber vielleicht ist er gerade deshalb interessant. Gerade die fortschreitende
Entwicklung hin zu einer multipolaren Welt bestärkt mich in der Auffassung, dass eine
Stärkung der Vereinten Nationen im Interesse des Westens sein sollte.
Die Hoffnung einer liberalen Weltordnung hat sich nicht erfüllt. Die beste Option
ist nun die Stärkung des kollektiven Sicherheitssystems der UN.
Westliche Politiker und politische Experten sehen in der UN kaum noch ein geeignetes
Instrument, um politische Problem zu lösen. Diese Einstellung geht auf die Zeit nach Ende das Kalten Krieges zurück, als man annahm, dass mit dem Sieg liberaler Demokratien eine
Organisation, in der nicht-westliche und illiberale Staaten ein Mitspracherecht so nicht braucht.
Die Zeiten haben sich aber geändert. Eine liberale Weltordnung, wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat, wird es so nicht mehr geben. Der Westen ist nun Teil einer multipolaren und politisch diversen Welt, in der Frieden nur erhalten werden kann, wenn unser Zusammenleben auf gemeinsamen Normen und Werten beruht, die gleichermaßen von westlichen und nicht-westlichen Ländern geteilt werden. Das kann allein durch eine UN erreicht werden. Die beiden Grundpfeiler der UN, die Charta mit dem Verbot militärischer Gewalt und die Allgemeinen Menschenrechte mit dem Gebot des Respekts für jeden Menschen, sind epochale Errungenschaft der Menschheit, die heute noch genauso gültig sind. Eine zukünftige Weltordnung muss darauf aufbauen.
Als 1989 die Berliner Mauer fiel, war die Hoffnung, dies werde ein Zeitalter weltweiten
Friedens einläuten. Als zwei Jahre später die gesamte kommunistische Welt zusammenbrach,
schien klar, dieser Frieden könne nur ein liberaler Frieden sein. Unter der Führung der einzigen Supermacht, der Vereinigten Staaten, würden sich nun demokratische und liberale Werte und eine freie Marktwirtschaft durchsetzen und weltweiten Frieden und wirtschaftlichen Aufschwung bringen.
Abschied von einer Hoffnung
Das ist nicht geschehen. Im Gegenteil, der Westen hat sich wiederholt in kostspielige
militärische Interventionen verstrickt, die nicht nur nicht gewonnen werden konnten, sondern ganze Regionen ins Chaos gestürzt haben. Die meisten dieser Interventionen waren nach internationalen Recht illegal und beruhten auf fragwürdigen Rechtfertigungen. Die UN-Charta war damit ausgehebelt. Und nicht nur das, im Zuge der militärischen Operationen gab es massive Menschrechtsverletzungen. Wir haben damit unsere eigenen Werte verraten.
In der Zwischenzeit hat der Westen viel seiner wirtschaftlichen Überlegenheit eingebüßt. In nur zehn Jahren, so ein Bericht der Standard Chartered Bank, wird nicht nur China, sondern auch Indien, gemessenen in Kaufkraft, die USA wirtschaftlich überholt haben. Unter den zehn stärksten Wirtschaften werden dann sieben nicht-westliche Länder sein. Der technologische Vorsprung, der die westliche Vormachtstellung für 400 Jahren garantierte, geht verloren.
Chinas Erfolg in der Entwicklung künstlicher Intelligenz, G5 Technologien und die erste
Landung auf der Rückseite des Mondes sind Zeuge dafür. Auch Indien hat mit dem Abschuss
20
eines Satelliten im Weltraum seinen technologischen Fortschritt – sowie seinen Machtanspruch demonstriert.
Demographische Entwicklungen schwächen den Westen. NATOs Anteil an der
Weltbevölkerung wird von 12 Prozent auf 10 Prozent in 2030 und auf 8 Prozent in 2100 fallen.
Dagegen vereinigt die Shanghai Cooperation Organization bereits heute 40 Prozent der
Weltbevölkerung. Europa ist besonders betroffen. War der Anteil Europas zur Zeit seiner
größten Machtentfaltung 1914 noch 27 Prozent, wird er in zehn Jahren auf 5 Prozent fallen.
War Afrikas Bevölkerung in 1945 knapp die Hälfte Europas, wird sie voraussichtlich in 2100
das Zehnfache betragen.
Kaum 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ist es nun der Westen, der Mauern baut. Mit
einer Mischung aus Siegerarroganz, militärischer Kurzsichtigkeit und der Obsession, die
Entstehung anderer Großmächte mit allen Mitteln zu verhindern, hat der Westen die einmalige Chance für einen liberalen Frieden vertan. Eine Ära ist zu Ende gegangen.
Rückkehr der Schlafwandler?
Der Sieger des Kalten Krieges fühlt sich nun selbst wieder bedroht. In einer Art Flucht nach hinten haben erneut die Auguren eines Kalten Krieges das große Wort. Russland und immer mehr auch China werden beschuldigt, den Westen und die liberale Weltordnung zerstören zu wollen. Begleitet von medialen Vorwürfen, setzen wir wieder auf Aufrüstung, Modernisierung von Atomwaffen, neue Waffensysteme und, als seien wir bereits am Rande eines Krieges, senden wir Militäreinheiten, Panzer und Raketenabwehrbatterien an die russische Grenze und Kriegsschiffe ins Chinesische Meer.
Aber für einen Kalten Krieg stimmen die Parameter nicht. Es gibt keine unvereinbaren
Ideologien, keine unversöhnlichen Machtblöcke, die um Weltherrschaft ringen. Weder
Russland noch China verfügen über politische Netzwerke, die weltweit Revolutionen und
Umstürze planen. NATO ist heute die einzig noch bestehende Militärallianz der Welt. Es gibt keinen Warschauer Pakt mehr und Russlands Militärausgaben betragen gerade 6 Prozent derer der NATO. Chinas Anteil an globalen Militärausgaben hat sich zwar auf 14 Prozent erhöht, ist aber immer noch gering verglichen zu den 68 Prozent westlicher Alliierter. Nicht nur quantitativ auch qualitativ bleiben westliche Militärtechnologien überlegen.
Es herrscht Marktwirtschaft, von Verstaatlichungen sprechen höchstens Jungsozialisten. Auch Staatskapitalismus und Industriespionage, die wir China vorwerfen, sind dem Westen nicht fremd und hohe Handelsüberschüsse gibt es auch in Deutschland. Die politischen Systeme in Russland und China erfüllen nicht demokratische Kriterien, aber das gilt auch für die meisten anderen Staaten, mit denen wir enge Beziehungen pflegen. Es wird weiterhin Differenzen und unterschiedliche Interessen geben, aber ein Kalten Krieg?
Viel eher könnten die heutigen Spannungen mit denen vor dem Ersten Weltkrieg verglichen
werden. Damals führten gegenseitige Verteufelungen gar nicht so gegensätzlicher europäischer Großmächte in den Krieg. Wie China heute, war es damals das Deutsche Reich, das mit wirtschaftlichen Erfolgen, die Vormachtstellung etablierter Staaten bedrohte. Und heute wie damals bleibt Russland, mit seinen riesigen Gebieten zwischen Asien und Europa, ein missverstandener Außenseiter. Und heute, wie damals, könnte ein lokaler Konflikt zu einer globalen Katastrophe führen.
21
Wie 1914 scheinen wir nicht zu wissen, was wir eigentlich wollen. Soll Russland, wie Präsident Obama hoffte, zu einer kleinen Regionalmacht reduziert und Chinas wirtschaftlicher Fortschritt gestoppt werden? Und wie sollten wir mit anderen aufkommenden
Wirtschaftsmächten umgehen? Träumen wir immer noch von liberaler Weltherrschaft? Sind
wir nach einer langen Zeit des Friedens wieder zu Schlafwandler geworden, die sich
selbstgerecht in militärischen Drohgebärden verlieren?
Unsere wirklichen Probleme
Dabei übersehen wir, dass nicht konkurrierende Großmächte, sondern schwache Staaten unser
größeres Sicherheitsproblem darstellen. Das Zerfallen staatlicher Autoritäten, der
Machtzuwachs bewaffneter nicht-staatlicher Akteure (NSA) und das Ausweiten
innerstaatlicher Kriege könnte zu einer Spirale der Gewalt führen, die weite Teile der Welt unregierbar machen.
Der Fragile States Index stuft aus 178 untersuchten Staaten 119 als instabil, davon 51 sogar als alarmierend instabil ein. Etwa 80 Prozent der Menschheit lebt in solchen instabilen Staaten.
Das könnte noch zunehmen. Bis 2100 soll die Weltbevölkerung um 3,5 Milliarden anwachsen.
Das entspricht der heutigen Bevölkerung von China, Indien, der EU und USA
zusammengenommen. Dieser Zuwachs wird fast ausschließlich in bereits instabilen Ländern
sein. Das könnte verheerende Konsequenzen haben.
Die entstehenden staatlichen Machtvakua werden durch die unterschiedlichsten NSA gefüllt.
Dazu gehören nicht nur bekannte Islamische Extremistenorganisationen, sondern auch viele
andere ideologisch, religiös oder ethnisch geprägte Gruppen, Unabhängigkeitsbewegungen,
Rebellen, Kriegsherren, Milizen, private Armeen, aber auch transnationale kriminelle
Organisationen, Drogenbarone, Menschenhändler, Clans and Gangs – und natürlich eine
Mischung aller. Es gibt m.E. keine Studie darüber, wie viele Menschen weltweit teilweise oder gänzlich von NSAs kontrolliert werden; die Wirklichkeit könnte aber erschreckend sein – auch für westlichen Länder. Damit haben auch bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Staaten und NSA dramatisch zugenommen. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind fast alle Kriegstote, Vertreibungen, Flüchtlinge und Zerstörungen das Ergebnis solcher innerstaatlichen Kriege.
Auch ausländische Interventionen sind heute ausschließlich Einmischungen in solche
Konflikte. Das könnte erst die Spitze des Eisberges sein. Wir müssen uns auf eine Zukunft
gefasst machen, in der Staat gegen NSA, NSA gegen NSA und soziale Gruppen gegen soziale
Gruppen kämpfen.
Eine ähnliche Situation bestand 1917/18, als hunderttausende Verarmte und Entrechtete die
angeblich gottgegebenen staatlichen Ordnungen in Europa hinweggefegten. In Zukunft
könnten es weltweit hundert Millionen Menschen, die aus einer Hoffnungslosigkeit staatliche Ordnungen und Grenzen überrennen. Der Westen würde dabei nicht verschont bleiben. Militärische Lösungen gibt es nicht; wir brauchen andere, politische Lösungen. Diese können nur innerhalb der UN gefunden werden.
In 2014, bei einem Treffen mit Putin, machte Präsident Obama den westlichen Standpunkt zur
Ukrainekrise klar: „Wir haben die Notwendigkeit betont, wichtige internationale Prinzipien
einzuhalten und eine solches Prinzip ist, nicht in andere Länder einzufallen oder Proxys zu unterstützen und finanzieren, um ein Land zu destabilisieren, das Mechanismen für
demokratische Wahlen hat.“ Wer könnte dem widersprechen. Nur, sollte nicht das gleiche
Prinzip auch für westliche Interventionen im Kosovo, Irak, Syrien, Libyen, Jemen und eben
22
auch in der Ukraine gelten? Es kann ja kein internationales Recht geben, dass nicht universal angewandt wird.
Obamas Erklärung hat noch einen weiteren Haken: für innerstaatliche Konflikte mit
ausländischen Einmischungen, wie in der Ukraine, gibt es das von ihm genannte internationale Prinzip so nicht. Die UN-Charta bezieht sich ausschließlich auf zwischenstaatliche Konflikte, jede Anwendung auf innerstaatliche Konflikte ist explizit ausgeschlossen. Auch die Anwendung Humanitären Völkerrechtes (IHL) auf innerstaatliche Kriege ist fraglich. Wollen wir Tragödien wie Syrien in Zukunft verhindern, müssen wir einen neuen Rahmen internationaler Normen und Rechte spezifisch für innerstaatliche Konflikte schaffen. Das müsste u.a. Rechte und Pflichten von Staaten und NSAs definieren, zivile und militärische Interventionen unter kollektiver Sicherheit stellen und die Anwendung allgemeiner Menschrechte und des IHL neu festlegen. Das braucht Zusammenarbeit, auch der Großmächte.
Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Großmächten sollten der Vergangenheit
angehören. Für die schrecklichen Waffensysteme ist unser Planet viel zu klein. Heute sind die meisten Konflikte sowieso interne Konflikte geworden. Um diese zu lösen sind die jährlichen 2,7 Billionen US-Dollar Militärausgaben sinnlos. Keine Atomwaffe, keine Überschallraketen, keine Flugzeugträger und keine B-2 Bomber werden uns da retten.
Bald leben 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Sie sind nicht unsere Feinde, sie sind unsere Mitverantwortung. Wir brauchen dazu keine Panzer; was zählt, sind funktionierende Staaten und internationale Zusammenarbeit, um Ziele zu erreichen, wie sie u.a. in der Agenda 2030 oder in den Pariser Klimaabkommen vereinbart sind. Dazu brauchen wir eben die Vereinte Nationen.
23
Artikel 5
Der Ukrainekrieg hätte bei Einhaltung des Völkerrechts verhindert werden können
Mit dem Ukrainekrieg müssen wir uns erneut die vielleicht wichtigste Frage für eine
friedliche Zukunft der Menschheit stellen: kann es eine Welt geben, in der Frieden und
eine internationale Ordnung durch gemeinsame Vereinbarungen unter Staaten
garantiert wird, oder wird es nur eine Ordnung geben können, die durch die militärische,
wirtschaftliche und politische Gewalt einer Hegemonialmacht durchgesetzt werden
kann? Das ist eine Frage, ob wir in einer Welt des Völkerrechts oder doch in einer Welt
des Rechts des Stärkeren leben werden. Hier dazu einige Gedanken.
Im Ukrainekrieg präsentieren sich die NATO-Länder als die Verteidiger des
Völkerrechts und einer nicht näher definierten „internationalen Ordnung“ gegen ein
Russland, das mit der Invasion in der Ukraine das Völkerrecht in eklatanter Weise
gebrochen hat und damit die internationale Ordnung zerstöre. Nur ist das auch so
einfach? Oder ist es nicht eher so, dass alle Kriegsparteien, und dazu gehören dann auch
die USA und ihre NATO-Verbündeten, das Völkerrecht wiederholt gebrochen, ja
missbraucht haben?
Und nicht nur das. Mit der Einhaltung des existierenden Völkerrechts durch alle
Konfliktparteien hätte dieser Krieg verhindert werden können. Unermessliches
menschliches Leiden mit dem Tod sowie den physischen und seelischen
Verstümmelungen hunderttausender Menschen auf beiden Seiten der Front wäre
vermieden worden. Die Ukraine wäre nicht durch Zerstörung, interne Zerrissenheit,
Verarmung, Verschuldung und einer verstärkt einsetzenden Entvölkerung an den Rand
des Kollapses getrieben worden und bestünde weiterhin in den Grenzen von 1991. Und
die Menschheit sähe sich nicht dem vielleicht größten Risiko eines nuklearen Konflikts
seit dem Kalten Krieg ausgesetzt.
In diesem Beitrag soll nicht entschieden werden, wann dieser Krieg begann, oder wer
die Hauptschuld für diesen Krieg trägt. Doch soll hier am Beispiel des Ukrainekrieges
auf die entscheidende Bedeutung eines auf der UN-Charta aufbauenden Völkerrechts zur
Erhaltung einer friedlicheren Weltordnung hingewiesen werden. Wenn wir einen
globalen Frieden ohne Waffengewalt erreichen wollen, geht das nur über den Weg eines
allgemein akzeptierten Völkerrechts.
Der Vorwurf des Völkerrechtsbruches
In den NATO-Ländern beherrscht der Vorwurf des völkerrechtswidrigen
Angriffskrieges Russlands und das daraus folgende Recht auf Selbstverteidigung alle
Diskussionen zum Thema Ukrainekrieg. Es ist diese nicht weiter hinterfragte Berufung
auf das Völkerrecht, mit der die NATO-Staaten ihre militärische Rolle im Ukrainekrieg
rechtfertigen.
24
Der Vorwurf der Völkerrechtswidrigkeit bezieht sich auf die UN-Charta. Und es ist
richtig; in der Charta haben sich alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, keine
militärische Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele einzusetzen (Artikel 2/4) und im
Falle eines Angriffs wird jedem Mitgliedsstaat das Recht auf individuelle und kollektive
Selbstverteidigung eingeräumt (Artikel 51). Die russische Invasion in der Ukraine war
somit völkerrechtswidrig. Das berechtigt die Ukraine, sich zu verteidigen und die
NATO-Staaten, die Ukraine dabei militärisch zu unterstützen.
Nur: Kann man mit der UN-Charta auch rechtfertigen, über mehrere Jahre einen Krieg
zu führen, der in der Zerstörung des angegriffenen Staates enden könnte? Und berechtigt
dies auch zu einer Ausweitung des Krieges auf Russland mit dem Risiko, einen
nuklearen Weltkrieg vom Zaun zu brechen? Und das alles, ohne auch nur den Versuch
zu unternehmen, den Konflikt, der zu diesem Krieg geführt hat, friedlich zu lösen? Wohl
kaum! Denn Sinn und Zweck der UN-Charta ist es ja, der Menschheit den Frieden zu
erhalten und nicht etwa Kriege zu rechtfertigen.
Das Friedensgebot der UN-Charta
Es ist eben das Friedensgebot der UN-Charta, dass ein Gewaltverbot miteinschließt –
und nicht umgekehrt. So heißt es auch gleich am Anfang der Charta, dass es das Ziel der
Vereinten Nationen ist, „den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren …
und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen
könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des
Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen; …“. (Artikel 1/1). Ähnliche
Aufforderungen, Konflikte durch Verhandlungen beizulegen, finden sich mehrfach in
der Charta.
Das ist im Falle des Ukrainekonflikts allerdings nicht geschehen. Dabei handelt es sich
hier um einen seit langem bekannten zwischenstaatlichen Konflikt gegensätzlicher
Sicherheitsinteressen (und nicht um eine ‚Vorgeschichte‘, wie oft verharmlosend in
Deutschland behauptet wird). Es ist daher ein typischer Konflikt, der im Sinne der UN-
Charta diplomatisch hätte gelöst werden sollen – und auch hätte gelöst werden können!
Denn bereits seit 1997 hatte Russland wiederholt klar gemacht, dass es eine Ausweitung
der NATO in die Ukraine und ins Schwarze Meer direkt an seinen Grenzen als
existenzielle Bedrohung ansehe. Russische Verhandlungsangebote wurden aber von den
USA und NATO-Staaten verweigert. Im Gegenteil; seit 2008 hat die NATO mit allen
Mitteln auf eine Mitgliedschaft der Ukraine hingearbeitet und dabei den Druck auf
Russland erhöht. Alle Verträge über Rüstungsbeschränkungen und vertrauensbildende
Maßnahmen mit Russland wurden gekündigt und Russlands nukleare
Zweitschlagfähigkeit durch Raketenabwehrsysteme in Rumänien und Polen
eingeschränkt. Die NATO hielt wiederholt militärische Manöver auf ukrainischem
Territorium und im Schwarzen Meer ab und unterstützte 2014 offen den bewaffneten
Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine, um so eine pro-NATO
Regierung in Kiew einzusetzen. Mit dem Minsker Abkommen hatten der Westen wohl
auch keine Lösung des Konfliktes, sondern nur Zeit für die Aufrüstung der Ukraine
gewinnen wollen. Damit hatten die NATO-Staaten einen Weg eingeschlagen, der eine
friedliche Lösung, wie in der UN-Charta vorgeschrieben, zunehmend unmöglich machte.
Das Argument, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sei kein Verhandlungsgegenstand, da die Ukraine ihre Sicherheitsvereinbarungen frei wählen
25
könne, ist so ebenfalls nicht richtig. Denn in der OSZE-Charta von Paris für ein Neues
Europa – auch das ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag – erklärten bereits im
Jahr 1990 alle europäischen Staaten sowie die USA und Kanada: „Sicherheit [auf dem
europäischen Kontinent] ist unteilbar und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist
untrennbar mit der aller anderen Staaten verbunden“. Im Istanbul Dokument der OSZE
von 1999 wurde das noch weiter präzisiert: „Jeder Teilnehmerstaat wird diesbezüglich
[gemeint sind Sicherheits-vereinbarungen] die Rechte aller anderen achten. Sie werden
ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten festigen.“
1. Die Verhinderung einer friedlichen Lösung
Sollte es zu einem Krieg gekommen sein, sind UN-Mitgliedsstaaten ebenfalls
verpflichtet, durch Verhandlungen eine friedliche Lösung zu finden. Im Falle des
Ukrainekrieges haben Russland und die Ukraine sich daran auch gehalten. Bereits drei
Tage nach Beginn der russischen Invasion hatten sich russische und ukrainische
Verhandlungsteams getroffen und bereits sechs Wochen später hatten beide Seiten sich
in Istanbul am 29. März 2022 auf ein Zehn-Punkte-Communiqué geeinigt, das das
Grundgerüst für einen all-umfassenden ukrainisch-russischen Friedensvertrag darstellte.
Das Communiqué führte dann aber nicht zu einem Friedensvertrag. Denn bereits wenige
Tage zuvor, am 24. März 2022, hatte die NATO auf einem Sondergipfel in Brüssel
klargemacht, dass sie derartige Friedensverhandlungen nicht unterstützen werde. Als
Präsident Selenskyj dennoch am Istanbuler Communiqué festhielt, machte der britische
Premierminister Boris Johnson bei einem Überraschungsbesuch in Kiew am 9. April
2022 den Ukrainern unmissverständlich klar, dass sie jede Unterstützung des Westens
verlieren würden, sollten sie einen Friedensvertrag mit Russland unterzeichnen.
Am 26. April 2022 erklärte dann noch der US-Verteidigungsminister, Lloyd Austin, dass
das Ziel der USA im Ukrainekrieg nun sei: „Wir wollen Russland derart schwächen,
dass es nie mehr in der Lage sein wird, Dinge zu tun, wie eine militärische Invasion der
Ukraine“. Damit haben die USA nun auch ein politisches Ziel im Ukrainekrieg
formuliert, dass sie mit militärischen Mitteln durchsetzen wollen. Tun sie hier nicht
genau das, was sie gerade Russland vorwerfen? Die Konsequenz war nun aber, dass jede
Möglichkeit eines frühen und umfassenden Friedens vertan war und die Ukraine in einen
Krieg versank, der nun ihre gesamte Existenz gefährden könnte.
Hätten sich die NATO-Staaten im Sinne der UN-Charta hinter die ukrainisch-russischen
Friedensverhandlungen vom März/April gestellt, hätte dieser Krieg spätestens nach zwei
Monaten beendet werden können – und das zu erheblich besseren Bedingung für die
Ukraine, als dies heute noch möglich wäre.
2. Das Prinzip gegenseitiger Souveränität
Die gegenseitige Anerkennung der staatlichen Souveränität war ein Eckpfeiler der
Friedensregelungen des Westfälischen Friedens und ist es bis heute geblieben. In der
UN-Charta ist das unter dem Begriff der „souveränen Gleichheit“ (im Originaltext:
„principle of sovereign equality“ in Artikel 2/1) verankert. Das bedeutet, dass jeder Staat das Recht hat, seine politische Ordnung selbst zu wählen und seine inneren
Angelegenheiten dementsprechend selbst zu regeln ohne Einmischung anderer Staaten.
Dieses Prinzip ist im Ukrainekonflikt eklatant verletzt worden.
26
Nach Aussage der damaligen amerikanischen Staatssekretärin für Außenpolitik Victoria
Nuland hatten die USA bereits vor 2014 fünf Milliarden Dollar in die „West-
Orientierung“ des Landes investiert. Für eines der ärmsten Länder Europas war das eine
riesige Summe. Sehr wahrscheinlich ist sogar, dass es sich um viel höhere Beträge
handelte, wie Gelder anderer westlicher Staaten sowie deren Geheimdienste und privater
Stiftungen. Auch haben westliche Politiker – der damalige deutsche Außenminister
Westerwelle gehörte dazu – sich immer wieder unter die zum Teil bewaffneten
Demonstranten auf dem Kiewer Maidan-Platz begeben und ihnen ihre Unterstützung
zugesagt – ein geradezu einzigartiger Vorgang, den kein westliches Land für sich
akzeptieren würde.
In einem abgehörten Gespräch von Nuland mit dem damaligen US-Botschafter in Kiew
wurde sogar besprochen, welchen besonders US-freundlichen Politiker man nach einem
gelungenen Umsturz zum ukrainischen Ministerpräsidenten machen solle. Und genauso
passierte es dann auch. Dass mit Janukovych ein demokratisch gewählter Präsident
abgesetzt wurde, der aus nationalen Wahlen hervorging, die von der OSZE und EU
damals als frei und fair bezeichnet wurden, schien im Westen niemanden zu stören. Ohne
diese völkerrechtswidrige Einmischung in die internen Angelegenheiten hätte es
wahrscheinlich zu keinem illegalen Umsturz, zu keinen Unruhen in vielen Teilen der
Ukraine und zu keiner Abspaltung der Krim und des Donbas geführt.
3. Das Universalitätsprinzip
Aber das vielleicht Erstaunlichste am westlichen Vorwurf, Russland führe einen
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, ist, dass gerade die USA und ihre NATO-
Verbündeten seit dem Ende des Kalten Krieges wiederholt selbst völkerrechtswidrige
Angriffskriege geführt haben. Uns sind noch die völkerrechtswidrigen Kriege gegen
Serbien (1999), gegen den Irak (2003), gegen Libyen (2011) und gegen Syrien (2014)
bekannt. Weniger bekannt ist, dass zwischen 1992 und 2022 die USA 251-mal
militärisch in anderen Staaten interveniert hatten (nach Angaben des wissenschaftlichen
Dienstes des US-Kongresses). Dabei sind CIA-Operationen und Unterstützungen in
Stellvertreter-Kriegen nicht einmal eingerechnet. Es ist wohl fair anzunehmen, dass die
überwiegende Mehrzahl dieser Interventionen nicht vom Völkerrecht gedeckt war. Der
Hegemonialanspruch der USA, der auf militärischer Stärke aufbaut, verträgt sich eben
nicht mit einer UN-Charta, dass die souveräne Gleichberechtigung der Völker und das
Friedensgebot zur Grundlage hat.
Ein Völkerrecht macht aber nur Sinn, wenn es universell ist – also für alle Staaten
gleichermaßen gilt. Durch die vielfachen völkerrechtswidrigen Interventionen von
NATO-Staaten wurde das Völkerrecht schon lange vor Russlands Angriff auf die
Ukraine ausgehebelt und so scheint der heutige Vorwurf an Russland unehrlich und
fragwürdig. Im Westen haben wir uns leider daran gewöhnt, unterschiedliche Standards
für uns und „die anderen“ zu akzeptieren. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass man
in NATO-Staaten gerne von einer fiktiven „regelbasierten internationalen Ordnung“ und
nicht mehr von einem Völkerrecht spricht.
Führt eine Zeitenwende zurück zum Völkerrecht?
Nun haben sich die Zeiten aber geändert und die USA sind längst nicht mehr die alleinige
militärische, wirtschaftliche, technologische und damit politische Supermacht, die sie
vor 30 Jahren noch waren. Heute werden die USA – und mit ihr ihre europäischen
27
Alliierten – die Macht mit anderen Staaten der Welt teilen müssen. Die Welt ist bereits
multipolarer geworden.
Und der damals herrschende Glaube, die USA würden als eine Kraft des Guten und des
Fortschritts durch ihre militärische Macht eine globale Ordnung schaffen, in der
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Aufschwung herrschten, hat sich
nicht erfüllt. Keine der 251 militärischen Interventionen, keine der CIA-Operationen und
keine der Waffenlieferungen in Stellvertreterkriegen haben je Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit oder wirtschaftlichen Wohlstand geschaffen. Sie haben nur Chaos,
Anarchie, wirtschaftlichen und sozialen Ruin und unermessliches menschliches Leiden
hervorgerufen. Der Ukraine steht wohl ein ähnliches Schicksal bevor.
Hegemonialansprüche und Waffen bringen eben keine Ordnung und keinen Frieden.
Vielleicht wird gerade dieser sinnlose und unmenschliche Ukrainekrieg uns zu der
Überzeugung bringen, dass die UN-Charta, die in dem gemeinsamen Gelöbnis aller 193
Mitgliedsstaaten von „Nie wieder Krieg“ und „Würde des Menschen“ gipfelt, eine
gleichberechtigtere, bessere und friedlichere Zukunft für die gesamte Menschheit
verspricht. Wir alle müssen uns nur noch daran auch halten wollen!
28
Artikel 6
Ist ein wiedervereintes Deutschland erneut auf dem Kriegspfad?
Als sich im Jahre 1945 – also unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem
europäischen Kontinent; in Asien dauerte er noch länger – die Delegierten der 50 alliierten Staaten trafen und sich auf die Charta der Vereinten Nationen zur Nachkriegsregelung einigten, war Deutschland noch ein Feindstaat. Es sollte dann auch bis 1972 dauern, bis die damals noch zwei deutschen Staaten in die Weltgemeinschaft der Vereinten Nationen (UN) aufgenommen wurden. Und es dauerte bis 1994, bis die unter anderem auf Deutschland bezogenen Feindstaatenklauseln in der Charta von der UN-Generalversammlung als „obsolete“ (hinfällig) erklärt wurden. Diese Klauseln wurden jedoch nie aus der UN-Charta entfernt. Deutschland wird dadurch dauerhaft daran erinnert, dass seine Kriegsverbrechen einst Anlass dafür waren, eine solche Charta zu schaffen.
Die Präambel der Charta bezieht sich ausdrücklich auf die beiden Weltkriege und spricht
davon, künftige Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal in unserem Leben unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat. Hier sollten sich Deutsche besonders angesprochen fühlen, da viele ihrer Vorfahren für das unsagbare Leid, das in den einunddreißig Jahren der Kriege zwischen 1914 und 1945 verursacht wurde, eine schwere Verantwortung trugen.
Es waren die Kriegserklärungen Deutschlands an Russland am 1. August 1914 und zwei Tage
später an Frankreich, mit denen ein lokaler Konflikt auf dem Balkan zum Ersten Weltkrieg
eskalierte. Und es war die bedingungslose Kapitulation Nazi-Deutschlands am 8. Mai 1945,
mit der der Zweite Weltkrieg in Europa beendet wurde. Die Rolle Deutschlands war damals
vom Großmachtstreben und der Überzeugung geprägt, Kriege für sich entscheiden zu können.
Die daraus resultierende Selbstüberschätzung führte bis hin zu einem mörderischen
Rassenwahn, dem Millionen unschuldiger Zivilisten – Juden, Polen, Russen, Weißrussen,
Ukrainer, Roma und andere als angeblich minderwertig angesehene Menschengruppen – zum
Opfer fielen. Die UN-Charta sollte ein solches Inferno für alle Zukunft verhindern.
Deutsche Regierungen – auch die heutige – sollten sich daher dem Friedensgebot der UN-
Charta in besonderem Maße verpflichtet fühlen. Doch scheint dies nicht der Fall zu sein.
Wenn man sich die Aussagen der aktuellen Bundesregierung anhört, bekommt man den Eindruck,
dass sich Deutschland wieder einmal auf dem Kriegspfad befindet. Das Klima ist von einer
wahren Kriegshysterie und einem Hass gegen Russland erfüllt. Es entsteht erneut der Eindruck einer Erbfeindschaft. „Russland wird immer unser Feind sein“, so der deutsche Außenminister, oder wenn der Bundeskanzler Putin den „schwersten Kriegsverbrecher unserer Zeit“ nennt.
Hier soll keineswegs ein Vergleich mit dem NS-Regime gezogen werden – das heutige
Deutschland ist ein völlig anderes. Und doch zeigen sich im Handeln der Bundesregierung so
viele Parallelen zu den beiden Weltkriegen, dass man sich fragen muss, warum deutsche
Politiker offenbar so wenig aus unserer Geschichte gelernt haben. Sind ihnen diese Parallelen nicht bewusst? Und sind sie wirklich überzeugt, dass es keine Alternative gibt, als auf einen Krieg mit Russland zuzusteuern?
29
Ist Krieg wieder legitimes Mittel der Konfliktlösung?
In den Rechtfertigungen der Bundesregierung scheint Krieg nun wieder als legitimes Mittel
zur Lösung von Konflikten angesehen zu werden. Demgegenüber wäre Diplomatie nur
Appeasement. Dass Deutschland damit das Friedensgebot des Grundgesetzes und der UN-
Charta verletzt, wird in der deutschen Debatte schlicht ausgeklammert.
In beinahe täglichen Appellen werden wir von der Bundesregierung und den etablierten Medien auf einen Krieg mit Russland vorbereitet. Und in diesem Krieg ginge es dann wieder einmal um die Ukraine – genau wie bereits im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Hätte man nicht
wenigstens dieses dritte Mal den Konflikt um die Ukraine gemäß der UN-Charta durch
Verhandlungen lösen können? Wäre das nicht auch im Interesse der Ukrainer, die unsere Politik mit ihrem Blut bezahlen? Nein, einem Putin könne man nur mit Stärke begegnen, so die Parole – auch wenn das eine Ausweitung des Krieges auf Deutschland bedeuten könnte.
Liegt hier unter deutschen politischen Eliten wieder einmal ein Hang zur Gewalt und eine gefährliche Selbstüberschätzung vor?
So sehen wir einen Bundeskanzler, der diesen Kriegsvorbereitungen nun höchste Priorität
einräumt. Er rühmt sich für seine „Friedensdiplomatie“, verfolgt aber in Wirklichkeit eine
Kriegsdiplomatie, indem er sich mit seinen Kollegen anderer EU-Staaten, dem britischen
Premierminister, dem ukrainischen Präsidenten und dem Generalsekretär der NATO
ausschließlich darüber berät, wie dieser Krieg doch noch gewonnen werden könne. Einen
Vorschlag für Friedensverhandlungen hat er nicht – und mit Russland, wie es eine echte
Friedensdiplomatie erfordern würde, spricht er schon gar nicht.
Der deutsche Verteidigungsminister nennt uns sogar bereits ein Datum: 2029, also in vier
Jahren soll der Krieg losgehen. Bis dahin, so appelliert er wiederholt, müsse Deutschland
kriegstüchtig sein. Das sind keine leeren Worte. Ein enormes Aufrüstungsprogramm wurde
beschlossen, und Maßnahmen wurden ergriffen, um dies ohne große bürokratische Hürden
schnellstmöglich umzusetzen. Die fortschreitende Deindustrialisierung Deutschlands wird gar als Chance gesehen, um durch freiwerdende Kapazitäten Panzerfahrzeuge und anderes
Kriegsgerät für den bevorstehenden Krieg produzieren zu können.
Der Plan sieht vor, dass sich die Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2029, also bis zum
angepeilten Kriegsbeginn, verdreifachen – auf 153 Milliarden Euro. (Russlands
Verteidigungsausgaben liegen in diesem Jahr bei geschätzten 121 Milliarden Euro.)
Deutschland soll wieder die stärkste Armee Europas haben; auch das hatten wir bereits zweimal zuvor – und es ist nicht gut ausgegangen.
Nun wird auch die Wehrerfassung aller wehrdienstfähigen Männer wieder eingeführt. Noch ist
sie freiwillig, doch falls nötig, soll laut Verteidigungsminister die Wehrpflicht erneut aktiviert werden. Zudem sollen Brücken und Straßen im Schnellverfahren verstärkt werden, um schweren Panzern und Kriegsgerät die Möglichkeit zu geben, ungehindert nach Osten
vorrücken zu können. Auch Krankenhäuser sollen umgerüstet werden, um auf einen möglichen
Krieg vorbereitet zu sein. Und um die rechte Stimmung zu erzeugen, präsentieren sich der
Bundeskanzler und sein Verteidigungsminister in voller Kampfausrüstung auf Panzern, auf
Kriegsschiffen und in Kampfflugzeugen.
30
Um all dies zu finanzieren, hat die neue Bundesregierung erneut Hunderte Millionen Euro an
neuen Krediten aufgenommen – man ist geneigt, von Kriegskrediten zu sprechen. Um
parlamentarische Mehrheiten zu sichern, wurde das bereits abgewählte Parlament ein weiteres Mal einberufen. CDU/CSU, SPD, die Grünen und FDP stimmten dafür, und die LINKE hat dies durch ihr Verhalten überhaupt erst ermöglicht. Hatten wir nicht schon früher eine solche parteiübergreifende Solidarität, um einen Krieg vorzubereiten?
Besonders beunruhigend sind die wiederholten Behauptungen des Bundeskanzlers, wonach
Russland bereits einen Krieg gegen uns führe. Das klingt verdächtig nach einem Vorwand, um
einen Gegenschlag Deutschlands zu rechtfertigen. Plant der Bundeskanzler einen
Präventivkrieg? Immerhin scheint sich Deutschland bereits an einer schleichenden
Stationierung von NATO Truppen in der Ukraine zu beteiligen. Wurde nicht ähnlich Juni 1941
argumentiert, als die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfiel – trotz eines bestehenden Nichtangriffspakts?
Auch die Nennung des Jahres 2029 als möglicher Kriegsbeginn sollte uns nachdenklich
stimmen, denn im Januar jenes Jahres würde die Präsidentschaft Donald Trumps enden. Will
man etwa auf einen neuen amerikanischen Präsidenten warten – in der Hoffnung, dass dieser
die Kriegspläne der europäischen NATO-Staaten unterstützt?
Dabei wird verschwiegen, dass ein Krieg mit Russland mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in
eine nukleare Auseinandersetzung münden würde, wobei dann sämtliche Aufrüstungsmaßnahmen und Kriegsvorbereitungen sinnlos wären – denn alles könnte dann schon nach wenigen Stunden vorbei sein. Dass Merz keine Angst vor einem Atomkrieg habe, deutet eher auf einen gefährlichen Realitätsverlust des Bundeskanzlers hin.
Sollte eine verantwortungsvolle deutsche Regierung nicht alles daransetzen, einen Krieg zu
verhindern, anstatt ihn durch Kriegsvorbereitungen noch zu provozieren? Sie ist dazu sogar
durch das Grundgesetz und die UN-Charta verpflichtet.
Deutschlands fragwürdiger Umgang mit dem Völkerecht
Wie vertragen sich all diese Kriegsvorbereitungen mit der UN-Charta und dem Völkerrecht?
Und was ist aus der einst geübten militärischen Zurückhaltung Deutschlands geworden? Strebt das inzwischen wiedervereinte Deutschland nun erneut nach globaler Größe und militärischer Macht?
Es war wohl kein Zufall, dass gerade der vermutlich bekannteste deutsche Diplomat und
damalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, unmittelbar nach der ersten Wahl Donald Trumps die provokanten Worte äußerte: „Wenn wir den Westen, wie wir
ihn kennen, erhalten wollen, dann müssen wir einsehen: Der Westen, das sind nun wir!“
(Interview in Die Welt, 26.11.2016). Mit anderen Worten: Angesichts der durch Trumps Wahl
ausgelösten Unsicherheiten in den USA müsse nun Europa – insbesondere Deutschland – die
Führung der sogenannten Freien Welt übernehmen. Von dort bis zur Erklärung von Friedrich
Merz, Deutschland solle zur stärksten Militärmacht Europas werden, war es dann nur noch ein kleiner Schritt.
D
as erste Opfer auf diesem Weg war der Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 zur Wiedervereinigung Deutschlands. In diesem Vertrag verpflichteten sich die beiden deutschen
Staaten völkerrechtlich bindend, im Falle einer Wiedervereinigung „keine seiner Waffen jemals
31
einzusetzen, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der
Vereinten Nationen“ (Artikel 2). Es dauerte nur neun Jahre, bis sich Deutschland 1999 am
völkerrechtswidrigen NATO-Krieg gegen das ehemalige Jugoslawien beteiligte und damit
diesen Vertrag in eklatanter Weise brach. Es kam zur militärisch erzwungenen Abtretung des
Kosovo – also zu Gebietsabtretungen, die ein Bundeskanzler Merz heute im Hinblick auf die
Ukraine vehement verurteilt.
Im Weißbuch der Bundesregierung zur Sicherheitsstrategie Deutschlands und zur zukünftigen
Rolle der Bundeswehr, erschienen 2016, wird der Zwei-plus-Vier-Vertrag nicht ein einziges
Mal erwähnt – obwohl das Dokument sich vorrangig mit der zukünftigen Rolle der
Bundeswehr befasst. Das mag daran liegen, dass Russland in diesem Weißbuch bereits als
Hauptgegner identifiziert wird. Doch das entbindet Deutschland nicht von den Verpflichtungen aus dem Vertrag.
Eine dieser Verpflichtungen ist der „Verzicht auf Herstellung und Besitz von sowie auf
Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen“ (Artikel 3). Unter dem
Programm der „nuklearen Teilhabe“ – so die NATO-Bezeichnung – lagern jedoch rund 20 US-
Atombomben (jeweils mit der 13-fachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe) auf dem
deutschen Fliegerhorst Büchel. Im Ernstfall sollen deutsche Kampfjets diese auf Ziele in
Russland abwerfen. Wie verträgt sich ein vertraglich eingegangenes Verbot der
Verfügungsgewalt über atomare Waffen mit einer solchen nuklearen Teilhabe Deutschlands?
Das Grundgesetz stellt klar, dass völkerrechtliche Regeln wie das Gewaltverbot der UN-Charta unmittelbar im deutschen Recht gelten (Artikel 25 GG). Doch im Weißbuch von 2016 findet sich dazu kein Hinweis. Zwar wird erwähnt, dass die Bundeswehr unter anderem mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten solle, doch dass das Gewaltverbot der UN-Charta
grundsätzlich auch für Bundeswehreinsätze gilt, bleibt unerwähnt.
Heute spielt Deutschland – ungeachtet aller völkerrechtlichen Bedenken – in den beiden
gefährlichsten Kriegen der Gegenwart die Rolle des Waffenlieferanten. Für die Ukraine ist
Deutschland dabei, nach dem Rückzug der USA, zum größten Waffenlieferanten zu werden.
Im Falle Israels ist Deutschland bereits der Zweitgrößte. Das lässt sich nicht nur als
fragwürdiges Geschäftsgebaren deuten, sondern auch als Ausdruck eines Deutschlands, das
nach globaler Bedeutung strebt.
Fazit
Mit seiner Kriegspolitik befindet sich Deutschland auf gefährlichen Abwegen. Es ist eine
Politik, mit der das Land seine Zukunft verspielt. Zunehmend verliert es an internationaler Bedeutung – wirtschaftlich, technologisch und diplomatisch. Eine Zerschlagung der Ukraine würde Deutschland Milliarden Euro kosten, und einen Krieg – selbst einen Kalten Krieg – mit Russland könnte es sich nicht leisten; er könnte den Untergang Deutschlands bedeuten.
Die Überheblichkeit, mit der Deutschland China begegnet, ist Ausdruck unüberlegter
Selbstüberschätzung. Wir sollten nicht versuchen, uns wie eine Großmacht zu verhalten, denn wir sind keine – und werden auch keine werden.
Wir dürfen uns auch nicht darauf berufen, dass ein Macron in Frankreich und ein Starmer im
Vereinigten Königreich Ähnliches tun. Es ist etwas anderes, wenn Deutschland versucht,
32
diesen ehemaligen Großmächten nachzueifern – oder gar eine Führungsrolle zu beanspruchen.
Schon bald könnten wir mit unserer Kriegspolitik allein dastehen, denn Frankreich und
Großbritannien stehen kurz vor dem wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch mit
unvorhersehbaren Konsequenzen auch für Deutschland.
Dass sich eine Kriegspolitik nicht auszahlt, sollten wir Deutschen aufgrund unserer Geschichte besser wissen als alle anderen. Gerade in diesen Zeiten geopolitischer Spannungen stellt eine Politik, die sich von der UN-Charta und des darauf aufbauenden Völkerrechts leiten lässt, eine reale politische Alternative dar – und könnte Deutschland helfen, einen Weg zurück zu einer Friedenspolitik zu finden.
33
ANNEX
Im Anfang war das Wort
Gedanken zur Charta der Vereinten Nationen
Hier noch einiges Wissenswertes zur UN-Charta, zu den UN-Institutionen, zu den UN-
Reformen und zu diesem Büchlein.
Zur UN-Charta
Die Charta wurde zuerst verfasst, und erst danach entstanden die Institutionen, die wir heute unter dem Begriff der Vereinten Nationen (UN) verstehen – also das UN-Sekretariat, der Sicherheitsrat, die Generalversammlung oder der Internationale Gerichtshof. Das ist zum Beispiel bei nationalen Verfassungen ganz anders: Dort existiert der Staat bereits, und die Verfassung regelt dann den rechtlichen Rahmen für die Menschen in diesem Staat (neu).
Was zunächst wie eine Haarspalterei klingt, ist für das Verständnis der UN von zentraler
Bedeutung. Denn das Fundament der Vereinten Nationen ist die Charta – nicht ihre
Institutionen. Wenn Mitgliedstaaten die Prinzipien der Charta nicht mehr anerkennen oder sie schlicht ignorieren, wird es keine Vereinten Nationen mehr geben. Bei Staaten ist das anders:
Sie verlieren ihre Souveränität nicht, wenn ihre Verfassung außer Kraft gesetzt wird.
Es geht daher nicht in erster Linie darum, ob die verschiedenen Institutionen der UN korrekt arbeiten, sondern vielmehr darum, ob alle Mitgliedstaaten nach den Prinzipien der UN-Charta handeln.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Die Charta ist in erster Linie ein politischer, nicht ein
rechtlicher Akt. Sie verkörpert den gebündelten politischen Willen der alliierten Mächte, die im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland und Japan kämpften, die Menschheit vor einer
erneuten Katastrophe zu bewahren. Deshalb lautet die zentrale Botschaft der Charta, dass
Konflikte zwischen Staaten durch Verhandlungen und nicht mehr durch militärische Gewalt
gelöst werden sollen. Das Gewaltverbot der Charta ist also eng mit dem Gebot zur
Verhandlung verknüpft – anders ergibt es keinen Sinn. Verhandlungen – insbesondere ernst
gemeinte zwischen Konfliktparteien – kann man nicht einklagen, auch nicht vor dem
Internationalen Gerichtshof. Sie müssen politisch gelöst werden.
Darum geht es auch in diesem Büchlein. Dabei fließen selbstverständlich meine Erfahrungen
aus 34 Jahren ein, die ich fast ausschließlich in Konflikt- und Kriegsgebieten in
verschiedenen Teilen der Welt für die Vereinten Nationen und kurzzeitig für die OSZE
gesammelt habe.
Zum Völkerrecht
Auch wenn es von vielen westlichen Staaten nicht mehr oder nicht mehr vollständig
anerkannt wird: Das Fundament des Völkerrechts ist die UN-Charta. Seit den 1990er-Jahren
spricht der Westen gerne von einer „regelbasierten Ordnung“, ohne diese jedoch klar
definieren zu können. Das wird von nicht-westlichen Ländern häufig als Affront empfunden.
34
Im Laufe der Zeit haben sich unzählige – jawohl, unzählige – Konventionen, internationale
Verträge und Agenden um die UN-Charta herum entwickelt. Sie regeln die internationale
Zusammenarbeit in nahezu allen Bereichen des menschlichen Lebens: Menschenrechte,
soziale, wirtschaftliche und technologische Fragen, Umweltbelange – und ganz besonders die
internationale Sicherheit.
Bei der Verabschiedung jeder dieser Konventionen usw. hat jedes Mitgliedsland ein
Mitspracherecht. Deshalb gibt es auch so viele internationale Konferenzen. Dafür wird die
UN oft kritisiert. Doch da 193 Staaten – so unterschiedlich wie Dänemark und Sierra Leone – etwas zu sagen haben und auch sagen sollen, geht es nicht anders.
Zu den Institutionen der Vereinten Nationen
Die Vereinten Nationen sind keine Weltregierung und auch keine Quasi-Weltregierung. Sie
sind im Wesentlichen ein nach Regeln organisiertes internationales Forum von
Regierungsvertretern – manchmal auch von Staatschefs aller Mitgliedsstaaten. Diese
repräsentieren heute 99,9 % der Weltbevölkerung. Und hier zeigt sich bereits das erste
Problem: In welchem Umfang repräsentieren sie diese Menschen tatsächlich? Doch daran
wird sich wohl nichts ändern lassen.
Jeder Mitgliedsstaat hat einen Sitz und eine Stimme in der UN-Generalversammlung. Und
hier liegt das zweite Problem: Der bevölkerungsreichste Mitgliedsstaat, Indien, mit fast 1,5 Milliarden Einwohnern, und Nauru mit nur 12.000 Einwohnern haben jeweils nur einen Sitz und eine Stimme. Ein demokratisches Parlament ist die UN-Generalversammlung daher
nicht. Deshalb verfügt sie auch über relativ wenige echte Kompetenzen. Dennoch ist sie eine Versammlung aller Staaten der Welt und damit ein Forum, in dem globale Probleme und
Konflikte besprochen werden können. Angesichts der erheblichen Unterschiede zwischen den
Staaten und ihrer Sichtweisen ist das eine überaus nützliche Einrichtung.
Die eigentliche Macht liegt im UN-Sicherheitsrat. Dieser ist für die Wahrung des Friedens in der Welt zuständig. Er ist die einzige Institution (genauer gesagt: ein Forum von
Regierungsvertretern) weltweit, die das Recht hat, über Fragen von Krieg und Frieden zu
entscheiden. Doch genau hier liegt ein zentrales Hindernis: Die fünf ständigen Mitglieder – die USA, Russland, China, Frankreich und das Vereinigte Königreich – verfügen über ein
Vetorecht. Ein einziges Veto genügt, um jede Entscheidung zu blockieren. Von diesem Recht
wird reichlich Gebrauch gemacht, am häufigsten durch die Sowjetunion bzw. Russland und
die USA.
Der UN-Sicherheitsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern verschiedener Staaten. Er setzt sich aus den genannten fünf ständigen Mitgliedern und zehn nicht-ständigen Mitgliedern
zusammen. Diese werden nach einer bestimmten regionalen Verteilung jeweils für zwei Jahre
gewählt. Und das ist durchaus bedeutsam: So ist derzeit etwa Sierra Leone Mitglied des UN-
Sicherheitsrates – ein Land, das vor nicht allzu langer Zeit noch von einem Bürgerkrieg
erschüttert wurde. Damals war Sierra Leone noch Teil der Beratungen im Sicherheitsrat,
heute entscheidet es mit über die Probleme anderer Staaten.
Die UN besteht zudem aus zahlreichen Agenturen, Organisationen und Programmen, die sich
mit speziellen Themen von Landwirtschaft bis zu Menschenrechten befassen. Dies soll hier
jedoch nicht weiter ausgeführt werden.
35
Zu Reformen der Vereinten Nationen
In der Literatur geht es meist um institutionelle Reformen der Vereinten Nationen. Ich stehe vielen – um nicht zu sagen den meisten – dieser Vorschläge eher skeptisch gegenüber. Man kann Institutionen ständig verändern und neue hinzufügen, doch ob das tatsächlich zu
Verbesserungen führt, halte ich für fraglich.
Ich glaube auch, dass weiterhin nur die Mitgliedsländer entscheiden sollten, dass die UN
ausschließlich durch Beiträge finanziert wird und dass Polizei oder Militär von Fall zu Fall von Mitgliedstaaten für klar definierte Aufgaben bereitgestellt werden. Die UN darf nicht den Weg der Europäischen Union gehen, in der zunehmend Technokraten das Sagen haben.
Ich bin überzeugt, dass die relative Schwäche und begrenzte Macht der UN ein großer Vorteil ist, um eine Vermittlerrolle in der Welt einzunehmen. Bescheidenheit gepaart mit Fachwissen wird die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die UN nur stärken.
Wie ich anfangs erläutert hatte, halt ich die UN-Charta für Entscheidend. Und hier sehe ich zwei Reformen, die nötig sind:
Die Zusammensetzung des Sicherheitsrates
Die Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrates stammt noch aus der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg und einer Zeit riesiger Kolonien. So sind vier der Ständigen Mitglieder ehemalige Kolonialmächte. Auch die regionale Aufteilung ist zugunsten Europas.
Wir leben aber zunehmend in einer total veränderten multipolaren Welt. Das muss im
Sicherheitsrat reflektiert werden. Damit würde sich auch das Gleichgewicht im Sicherheitsrat zugunsten des „Globalen Südens“ verändern. Der „Westen“ wird hier an Macht abgeben müssen.
Die Erweiterung der UN-Charta um mit inner-staatlichen Konflikten
Die UN-Charta wurde seinerzeit entwickelt, um Kriege zwischen Staaten zu verhindern.
Hingegen sind heute fast alle Kriege innerstaatliche Konflikte zwischen einer Regierung und bewaffneten nicht-staatlichen Akteuren. Dafür ist die Charta nicht ausgelegt, sie muss dieser Entwicklung zu innerstaatlichen Konflikten und Kriegen aber zunehmend Rechnung tragen.
Michael von der Schulenburg, Jahrgang 1948, langjähriger UN-Diplomat und derzeit EU-
Abgeordneter über die Liste des BSW, war seit den 1980er bis in die 2010er Jahre zahlreichen Konflikt- und Kriegszonen für die Vereinten Nationen aktiv. Auch in die Verhandlungen im März 2022 zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul war er eingebunden. Sein Auftrag: Frieden schaffen.
Seine Maxime:
Die Charta der Vereinten Nationen als Grundlage einer globalen Friedensordnung ohne Kriege
– formuliert und beschlossen 1945, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und verbindlich
für alle Mitgliedstaaten der UNO.
Der Text kann als E-Book und als PDF auf Deutsch und Englisch kostenlos von der Webseite des BSW im Europäischen Parlament unter Link heruntergeladen werden.
Weitere Artikel, nach dem Datum ihres Erscheinens geordnet, zum Thema
Internationales:
15.10.2025: Belgien: 140.000 Menschen sind am 14. Oktober durch die Straßen von Brüssel gezogen
10.10.2025: Großbritannien: Streikwelle rollt wieder an
10.10.2025: Schweiz: Debatte über Wahlrecht für Senioren
Alle Artikel zum Thema
Internationales
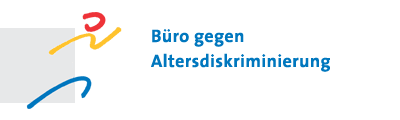
 Seite
drucken
Seite
drucken